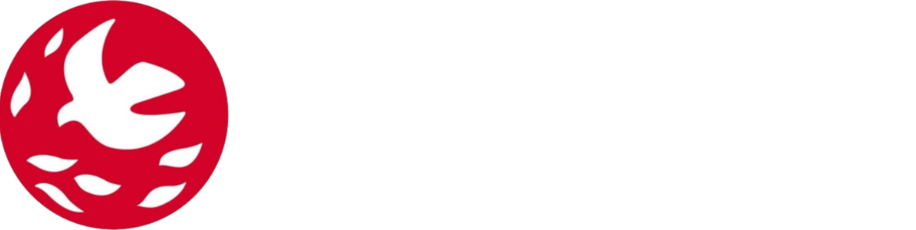Predigt Christmette 2023
Liebe Schwestern und Brüder,
in der Nacht von Bethlehem öffnet sich der Himmel . Der Glanz aus der Höhe umstrahlt die Menschen, die um die Krippe versammelt sind. Und Engel verkünden den Frieden auf Erden.
Alle Jahre wieder wird uns an Weihnachten eine wunderbare Geschichte erzählt.
Wir hören sie gern.
Und wissen doch nicht so recht, ob wir ihr glauben sollen.
In diesem Jahr, Weihnachten 2023, mag die Weihnachtsgeschichte manchen vielleicht wirklich nur noch wie ein Märchen erscheinen aus uralten Zeiten als das Wünschen noch geholfen hat.
Wir können die Realität unserer Welt ja nicht einfach ausblenden, wenn wir aufbrechen zum Gottesdienst in der Heiligen Nacht.
Die Pandemie ist in ihrer Wucht zwar inzwischen abgeklungen. Aber sie hat tiefe Gräben und Langzeitschäden hinterlassen.
Inzwischen sind Kriege hinzugekommen, die uns buchstäblich nahegehen: der andauernde Krieg in der Ukraine. Und der Krieg im tatsächlich „nahen“ Osten, mit seinen Auswirkungen auch bei uns:
Dass jüdische Menschen in Deutschland ihr Lichtfest Chanukka dieses Jahr in Ängsten gefeiert haben, dass manche es nicht gewagt haben, den Chanukka-Leuchter ins Fenster zu stellen, damit man nicht sieht, dass hier eine jüdische Familie wohnt, muss uns zutiefst beunruhigen.
Die Erschütterung über den Antisemitismus, der sich wieder so unverhohlen zeigt, geht dabei einher mit dem Entsetzen angesichts des maßlosen Leids, das wehrlosen Menschen in Palästina zugefügt wird.
Der Terrorangriff der Hamas in seiner bestialischen Brutalität und der Krieg, der seitdem entfesselt ist, lassen doch auch in der Christmette fragen, was in aller Welt die Botschaft der Engel vom Frieden auf Erden denn noch bedeuten soll, wenn Hass und Gewalt nicht einmal vor Kindern sich zügeln, einfach weil sie die Kinder der „anderen“, die Kinder des Feindes sind.
Ohnmacht, Trauer, Wut und Betroffenheit begegnen allenthalben. Auch in uns selbst. Auch in dieser Stunde.
Gefühlslagen eines Lebens im „Krisenmodus“, wie das Wort des Jahres die Situation präzise benennt.
Und doch haben wir uns aufgemacht zur Feier der Christmette in der Heiligen Nacht.
Trotzdem.
Oder sollte man besser sagen: „Gerade deswegen!“ ?
Weil wir uns von ihr einen Trost erhoffen, eine Ermutigung, einen Lichtstreif der Hoffnung?
Wir sind gekommen, um diese alte Geschichte wieder zu hören. Wir hören sie gern.
Die Weihnachtserzählung ist kein historischer Bericht.
Aber sie ist auch kein Märchen.
Sie gibt keine vordergründigen Antworten auf die Fragen, die uns auch heute Nacht umtreiben und quälen und täuscht keine falsche Sicherheit vor.
Aber sie weist eine Richtung. Sie kann Halt geben und eine Orientierung.
Sie ist sehr einfach:
Sie erzählt von zwei Menschen, die herumgestoßen sind und niemandem willkommen. Die aber einem Kind das Leben schenken. Und dass es, inmitten der Nacht, hell um sie wird.
Sie erzählt von den Hirten, draußen auf den Feldern vor Bethlehem, denen in dieser Nacht eine große Freude verkündet wird: Ein Kind ist euch geboren!
Es ist, dieses Kind, auch uns, sagt die Weihnachtsgeschichte, wie damals den Hirten zum Zeichen gegeben:
Verwundbar, verletzlich und wehrlos, in Armut und äußerster Angewiesenheit kommt in ihm Gott selbst uns Menschen entgegen.
Er ist im Kleinsten und Schwächsten verborgen:
Ein Gott, den man, wie dieses Kind, wärmen, nähren und in einer kalten, gewalttätigen Welt beschützen muss.
Unser verletzliches, gefährdetes Leben ist sein Inkognito.
Er ist,
so wird es dieses Kind, erwachsen geworden, verkünden und vorleben, wenn Jesus auf den Straßen und Plätzen in Galiläa – auch da: allem Anschein zu Trotz – den Anbruch seines Friedensreiches ausruft,
in den Kleinen und Schwachen, in denen am Rand, den Verlorenen und Verwundeten, den Trauernden und den Klagenden.
Und in und über denen, die nicht vorübergehen, sondern sich zuwenden, geht sein Himmelreich auf.
Unser Menschsein in Größe und Elend, die Mitmenschlichkeit, die wir darin einander erweisen, ist das Sakrament der Gottesbegegnung.
Ist das nicht die Quintessenz unseres Glaubens an den menschgewordenen Gott? Der Grund auf dem wir stehen?
Uns daran zu erinnern – dazu feiern wir Weihnachten.
Es ist ja kein Zufall, sondern in ihr selbst angelegt, dass fromme Phantasie diese Erzählung weitergesponnen hat und in Legenden etwa sich ausmalt, wie die Hirten, diese rauen Gesellen, vor der Krippe auf einmal ganz fürsorglich werden und zärtlich und dem Kind mit dem wenigen, was sie haben, Milch, Käse, Wolle und dem Spiel der Hirtenflöten in seiner Bedürftigkeit beizustehen versuchen.
Und wenn wir uns fragen, wo er denn sei, der „Immanuel“, der „Gott mit uns“ in dieser Welt, in der auch an Weihnachten kein Friede ist, dann verschiebt diese Geschichte unsere Perspektive:
Nicht bei Kaiser Augustus, damals wie heute: nicht in den Zentren der Macht, sondern am Rand, im unbedeutenden Bethlehem, damals wie heute: an den Peripherien ist er zu finden.
Bei den Namenlosen und Kleinen, bei den Mitfühlenden und Barmherzigen, bei denen, die Solidarität erweisen.
Bei den Hirten, die sich einfinden an der Krippe.
Mit offenen Herzen und offenen Händen.
Der „Immanuel“, „Gott mit uns“: gegenwärtig als der Menschgewordene in unserer Mitmenschlichkeit.
Auch in diesem Jahr sind wir zusammengekommen, um uns im gemeinsamen Hören auf eine vertraute Geschichte trösten und in unserer Hoffnung stärken zu lassen.
Gerade in diesem Jahr!
Das Dunkel um uns und die Schatten in uns, die Stimmen, die uns versuchen, uns in Gleichgültigkeit einzurichten, uns der Resignation zu überlassen oder gar mit Zynismus zu immunisieren für ein Leben in einer Welt im „Krisenmodus“, sollen nicht das letzte Wort haben:
Wie mächtig Gewalt und Unrecht auch scheinen, wie radikal das Sinnwidrige und Böse auch sein mag, Weihnachten sagt uns:
Die Güte ist tiefer und reicht weiter.
Sie ist in der Welt. Eine universale Macht.
Wir dürfen ihr vertrauen.
Sie trägt in allen Anfechtungen und Kämpfen, als wären wir darin „von guten Mächten wunderbar geborgen“.
Heute. Und an jedem neuen Tag.
Amen