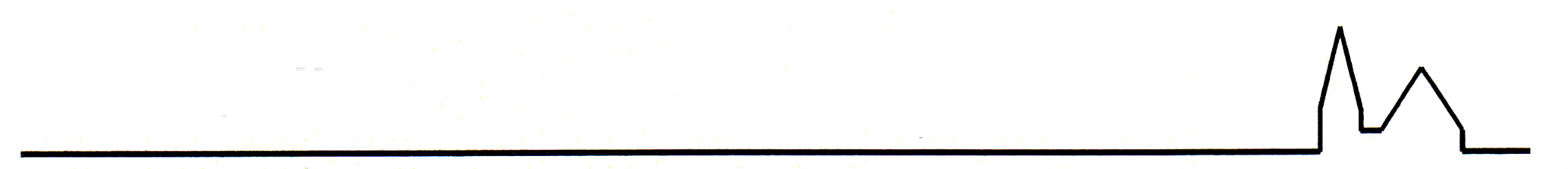Allen Gemeindemitgliedern und Besuchern der Homepage eine frohe und gnadenreiche Weihnachtszeit!
Weihnachtsgrüße unseres Dekans
Advent und Weihnachten: sie stehen für Weggeschichten schlechthin.
Das Kommen des Sohnes Gottes in unsere Welt setzt Menschen in Bewegung,
freiwillig oder durch höhere Weisung genötigt. Sie haben alle dasselbe
Ziel, einen kleinen Ort in Israel namens Betlehem, ein Kind, das in
einer Futterkrippe liegt. Eigentlich ein ganz unspektakulärer Beginn
eines Geschehens, das die Welt verändern wird. Es wird Menschen
zusammenbringen, die zuvor durch alle möglichen Schranken voneinander
getrennt waren: soziale Unterschiede, Sprache, kulturelle Prägungen,
Vorurteile und Voreingenommenheiten. Aber dieses Betlehem ist auch ein
Ort mit einer großen Vergangenheit. Es ist die Geburtsstadt des Königs
David, der großen Idealgestalt des Volkes Israel, aus dessen Geschlecht
sowohl Niedergang und Katastrophe wie auch Verheißung für sein Volk
erwachsen sind.
Gott macht sich offenbar nicht sichtbar in Glanz und Pracht,
sondern in der Armut und Unscheinbarkeit eines kleinen Stalls. Gott geht
an die Ränder. Damit steht er ein für zwei grundlegende Kennzeichen
von Kirche, die Option für die Armen und die Notwendigkeit, nicht in
einer vermeintlich sicheren Wagenburgmentalität zu verharren, sondern
hinauszugehen, um die Freude der Menschen ebenso zu teilen wie ihre
Sorgen und Ängste. In diesen Zeiten einer weltumspannenden Pandemie
betreffen uns solche Erfahrungen und Begegnungen unmittelbar, in den
eigenen Familien, im Lebensumfeld, am Arbeitsplatz. Gleichzeitig sind
wir herausgefordert, eine soziale Distanz einzuhalten, um uns und andere
möglichst vor Schaden zu bewahren. Schutz durch Abgrenzung, durch
Isolation. Das kennen wir zur Genüge aus nationalistischen Ideologien.
Im Umgang mit den Menschen, die uns nahe sind, bedeutet es eine völlige
Abkehr vom Gewohnten und Vertrauten. Mit den Folgen haben wir alle zu
kämpfen. Zugegeben: die Technik stellt uns vielfältige
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung, zeigt aber auch gleichzeitig deren
Grenzen auf.
Advent und Weihnachten, da sind Menschen in Bewegung
Normalerweise. Aber in diesem Jahr ist eben vieles nicht normal. Wege
erweisen sich als Sackgassen, als Irrwege, oder sind schlicht
unmöglich. Wir wünschen uns Wege aus der Pandemie und tun uns schwer,
gangbare Wege in der Pandemie zu finden. Das gilt für die Politik wie
für den privaten Bereich. Aber Untätigkeit führt zu nichts. Um uns
herum bleibt die Welt nicht stehen. Sie verändert sich unentwegt. Wenn
wir die daraus resultierenden Folgen nicht als unabänderlich hinnehmen
wollen, gilt es zu handeln. Advent und Weihnachten führen uns vor
Augen, wie unkonventionell Gott mit den Problemen seiner Welt umgeht.
Seine Leitgedanken sind Liebe und Barmherzigkeit. Davon sollten wir
nicht nur reden, wir sollten es ihm nachtun. Daran arbeitet sich die
Kirche in unserem Bistum gerade ab. Sie versucht in den Strukturen, die
sie zugegebenermaßen (noch?) nicht ändern kann, Neues zu schaffen.
Auch dir Kirche ist immer in der Gefahr zu erstarren. Wenn sie versucht,
Neues zu verwirklichen, steht sie vor einer doppelten Herausforderung.
Sie muss sich den Fragen und Ansprüchen der Gegenwart stellen und
gleichzeitig verbunden bleiben mit dem, was ihr von der befreienden
Lebensbotschaft des Evangeliums aufgetragen ist, ihrer DNA sozusagen.
Daher kann das Neue nicht in einer Renovierung der alten Strukturen
liegen, so dass ein schmucker Anstrich die Schwachstellen nur verbirgt.
Es kann auch nicht um ein bloßes Erhalten kirchlicher
Funktionsfähigkeit nach innen und außen gehen. Vielmehr geht es darum,
dass wir einander Rechenschaft geben über das, was uns im Vollzug des
Glaubens wichtig ist, und dadurch Zeugnis, von der Hoffnung, die uns
erfüllt. Auf diesem dornenreichen und gleichermaßen erfüllenden Weg
sind hunderte Menschen in unserem Dekanat Darmstadt gegenwärtig
miteinander unterwegs. Sie reihen sich damit ein in die große Schar
derer, die vor ihnen auf dem Weg waren, beginnend mit Abraham, der
allein im Vertrauen auf die Verheißung Gottes Heimat und Sicherheit
verließ. Die Bibel spricht von seinem Gehorsam, aber sicherlich darf
man auch an die Faszination denken, die die Vorstellung eines neuen
Landes von jeher im Menschen auslöst. Dafür sind auch Abraham und Sara
nicht zu alt. Sie wissen: Es gibt Isaak, ihren Sohn, der die Verheißung
weiterträgt. Das Vertrauen auf Gott verbürgt Zukunft. Auch für uns.
Das gilt ebenso für Mose. Er führt sein Volk aus der bedrückenden
Enge Ägyptens in die Freiheit der Selbstverantwortung. Aber es ist ein
jahrzehntelanger Weg durch die Wüste, mit vielen Irrungen, Zweifeln und
Widerständen. Mose ist mehr als einmal versucht, die ganze Sache Gott
vor die Füße zu werfen. Es ist zuviel, es bringt doch nichts. Am Ende
erreicht er das von Gott zugesagte Ziel. Das verheißene Land wird er
nicht betreten, er sieht es von ferne. Das könnte ein Sinnbild sein
für das, worum es geht. Wir sollten nicht den Anspruch haben,
Endgültiges zu bewirken und selbst diejenigen zu sein, die am Ziel
angekommen sich nun behaglich einrichten können. Das Ziel kann nur
sein, Räume zu schaffen, in denen, mit Mut zur Veränderung und mit
Zuversicht, Glaube jetzt und in Zukunft gelebt werden kann. Mit weniger
sollten wir uns allerdings nicht zufrieden geben.
Der Pastorale Weg im Bistum Mainz ist mit vielen Bildern verknüpft
Darin spiegeln sich die ganz realen Aktivitäten: physische oder in hohem Maße digitale Treffen und Diskussionen, Entscheidungen, Dokumentationen. Dabei stellt sich die
Frage, wer diesen Weg mitzugehen bereit ist, zur Gänze oder in
Abschnitten, wie bei einem langen Pilgerweg. Wer steht am Rand und ist
interessiert? Wer wendet sich ab? Letztlich: Werden wir dem Anspruch
gerecht, Lösungen für alle Menschen anzubahnen? Wird das pilgernde
Gottesvolk einen gemeinsamen Weg zu gehen bereit sein? Werden wir diesen
gemeinsamen Weg zueinander finden? Die Weisen aus dem Orient folgen
einem Stern. Es ist ihr Stern. Doch zurück nach Hause gehen sie eine
andere Strecke. Sie haben die Wahrheit der Verheißung begriffen, sie
haben gesehen und gelernt. Der alte Weg kann jetzt nicht mehr gelten.
Aber sie kommen zurück in ihre Heimat.
Ihr Dekan Dr. Christoph Klock