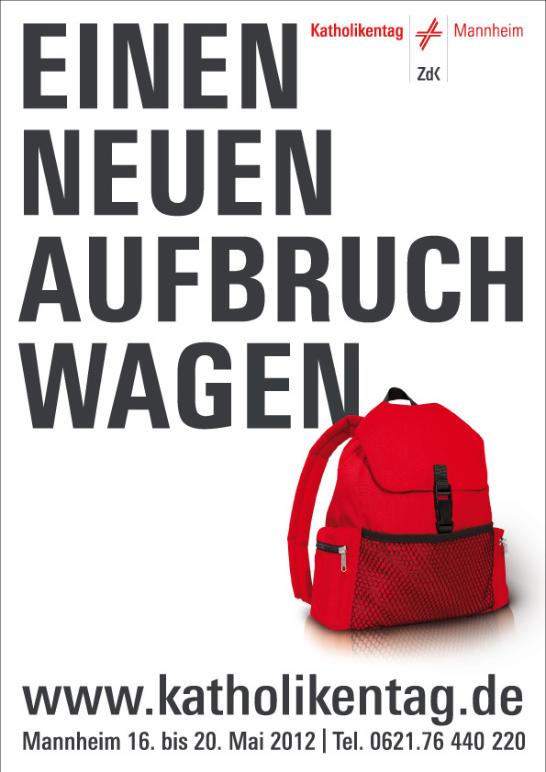Mainzer Bistumsnachrichten Nr. 13
vom 11. April 2012
Bischöfliche Pressestelle Mainz, Leiter: Tobias Blum, Bischofsplatz 2, 55116 Mainz
Postanschrift: Postfach 1560, 55005 Mainz, Tel. 06131/253-128 oder -129,
Fax 06131/253-402, E-Mail: pressestelle@bistum-mainz.de
Vorschau
- Das Bistum Mainz auf dem Katholikentag (16.-20.5.)
- Malteser pilgern nach Rom (29.9.-6.10.)
Personalien
- Clemens Breitschaft wird Domchordirektor in Osnabrück
Bericht
- Weihbischof Neymeyr predigte in der Osternacht
Dokumentationen
- Osterpredigt von Kardinal Lehmann
- Predigt des Bischofs an Karfreitag
Vorschau
Das Bistum Mainz auf dem Katholikentag in Mannheim (16.-20.5.)
Mehrere Termine von Kardinal Lehmann / Druckwerkstatt beim Bistumsstand
Mannheim. Das Bistum Mainz wird auf dem 98. Katholikentag von Mittwoch, 16., bis Sonntag, 20. Mai, in Mannheim in vielfältiger Weise vertreten sein. Neben dem Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, nehmen auch Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr und zahlreiche Vertreter aus dem Bischöflichen Ordinariat und dem ganzen Bistum an den Veranstaltungen in Mannheim teil. Ein wichtiger Treffpunkt für die Mainzer wird dabei wieder der Bistumsstand der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit sein. Dort sind die Besucher dazu eingeladen, in der Druckwerkstatt zum Katholikentagsmotto „Aufbruch" kreativ selbst Hand anzulegen. Der Stand des Bistums Mainz steht auf dem Alten Messplatz in Mannheim (Bistumsmeile).
Leitwort: „Einen neuen Aufbruch wagen"
Der Katholikentag soll ein Forum bieten, um sich „mit gläubiger Zuversicht und wachem Verstand den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen". Das sagte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Alois Glück, bei der Programmvorstellung im Februar. Zu der Veranstaltung unter dem Leitwort „Einen neuen Aufbruch wagen" werden mindestens 25.000 Dauerteilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet sowie 30.000 Tagesgäste aus der Region erwartet. Das Programm des Katholikentags umfasst mehr als 1.200 Einzelveranstaltungen, darunter große Podien mit prominenten Teilnehmern aus Politik, Kirche und Gesellschaft. Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in der Regel alle zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. Der 97. Deutsche Katholikentag fand 2008 in Osnabrück statt, 2010 trafen sich Christinnen und Christen beim Zweiten Ökumenischen Kirchentag in München.
Termine von Kardinal Lehmann und Weihbischof Neymeyr
- Donnerstag, 17. Mai, 18.30 bis 19.30 Uhr
Stadthaus N1, Ebene 2, Bürgersaal N1
Gemeinsame Feier mit Kardinal Lehmann und Rabbiner Julien-Chaim Soussan aus Düsseldorf unter der Überschrift „Im Angesicht Gottes. Juden und Christen rufen nach Gerechtigkeit und Frieden" (135 - Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Seitenzahl im Programmheft) - Freitag, 18. Mai, 20.00 bis 22.00 Uhr
CC Rosengarten, Ebene 1, Wolfgang Amadeus Mozart-Saal, Rosengartenplatz 2
Teilnahme von Kardinal Lehmann beim Galaabend zum 50. Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils („Fenster auf! Die große Konzilsgala. Ein festlicher Abend zum 50sten") mit Verleihung des Aggiornamento-Preises (29) - Samstag, 19. Mai, 9.30 bis 10.30 Uhr
CC Rosengarten, Ebene 3, Gustav Mahler-Saal, Rosengartenplatz 2
Biblischer Impuls mit Kardinal Lehmann zum Thema „Die Berufung des Propheten und die Reaktion. Eine zweite Chance für Jona" (56) - Donnerstag, 17. Mai, 16.00 bis 17.30 Uhr
Jungbuschhalle Plus X, EG, Sporthalle, Werftstraße 10
Podium mit Weihbischof Neymeyr zum Thema „Wie ticken Jugendliche 2012 - die neue Sinus-Studie U18. Ergebnisse und erste Überlegungen für jugendpastorales Handeln" (247) - Freitag, 18. Mai, 14.00 bis 15.30 Uhr
Jungbuschhalle Plus X, EG, Sporthalle, Werftstraße 10
Podium mit Weihbischof Neymeyr zum Thema „Leben.Lernen. Wo bleiben Räume für Jugendverbandsarbeit?" (248)
Weitere Teilnehmer aus dem Bistum Mainz
Donnerstag, 17. Mai:
- 14.00 bis 15.30 Uhr
Johannes Kepler-Schule, 1. OG, Raum 105, K5, 1
Werkstatt mit Dr. Barbara Huber-Rudolf, Referentin für den interreligiösen Dialog im Bistum Mainz, zum Thema „Quellen des Glaubens. Die Heiligen Bücher, Quellen und Erzählungen" (128) - 14.00 bis 15.30 Uhr
CC Rosengarten, Ebene 3, Gustav Mahler-Saal, Rosengartenplatz 2
Podium mit Bianka Mohr, BDKJ-Diözesanvorsitzende in Mainz, zum Thema „Auftreten statt austreten. Einstehen für eine glaubwürdige Kirche" (61) - 14.00 bis 15.00 Uhr
Schlosskirche, Bismarckstraße
Uraufführung der „Missa Juvenalis" von Regionalkantor Thomas Gabriel, Seligenstadt, mit Kammerchor und Jugendkantorei St. Georg aus Bensheim (334) - 16.00 bis 17.30 Uhr
CC Rosengarten, Ebene 3, Gustav Mahler-Saal, Rosengartenplatz 2
Podium mit Schwester Miriam Altenhofen SSpS, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz und Provinzleiterin der Steyler Missionarinnen aus Mainz, zum Thema „Zuhören statt verleugnen - verändern statt beschönigen. Kirche stellt sich den Fragen von Opfern sexuellen Missbrauchs." (76) - 16.00 bis 17.30 Uhr
Eberhard Gothein-Schule, Aula, U2, 2-4
Podium mit Professor Dr. Stephan Goertz, Moraltheologe an der Katholischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, zum Thema „Recht zum Sterben oder Pflicht zum Leben? Fragen an Medizin, Theologie und Ethik" (175) -
16.00 bis 17.30 Uhr
CC Rosengarten, Ebene 2, Johann Wenzel Stamitz-Saal, Rosengartenplatz 2
Podium mit Pastoralreferentin Sonja Knapp, Leiterin des Gemeindezentrums St. Elisabeth in Mainz-Kastel, zum Thema „Von der Nabelschau zur MenschenSicht. Aufbrechen zur solidarischen Gemeinde" (270) - 20.00 bis 22.00 Uhr
Heilig Geist, Gemeindehaus, Gemeindesaal, Moltkestraße 14
Lesung mit Andrea Schwarz aus Viernheim unter der Überschrift „Bleib dem Leben auf der Spur - vom Aufbrechen und Ankommen" (274)
Freitag, 18. Mai:
- 11.00 bis 12.30 Uhr
Ursulinen-Gymnasium, EG, Raum 16, A4,4
Vortrag und Diskussion unter anderen mit Schwester Franziska Spang von den Klarissen-Kapuzinerinnen im Kloster der Ewigen Anbetung in Mainz zum Thema „Gestalten des Aufbruchs. Klara von Assisi - selbstbestimmt glauben" (93) - 11.00 bis 12.30 Uhr
Karl Friedrich-Gymnasium, 2. OG, Raum 206, Roonstraße 4-6
Werkstatt mit Hubert Frank, Männerseelsorger im Bistum Mainz, zum Thema „Männergruppen leiten. Impulse für die Praxis" (164) - 11.00 bis 12.30 Uhr
Eberhard Gothein-Schule, 3. OG, Raum 308, U2, 2-4
Bibliolog mit Andrea Schwarz aus Viernheim zum Thema „Der Rat des Schwiegervaters. Entlaste dich, gib anderen Verantwortung - Gen 18,13-27" (186) - 11.00 bis 12.30 Uhr
Heilig Geist, Gemeindehaus, Gemeindesaal, Moltkestraße 14
Podium mit dem Mainzer Diözesanpriester, Professor Dr. Richard Hartmann, Pastoraltheologe in Fulda, zum Thema „40 Jahre Würzburger Synode. Orientierung für die Kirche der Zukunft" (264) - 12.30 bis 14.00 Uhr:
St. Sebastian, F1
Eucharistiefeier mit Diözesanjugendseelsorger Pfarrer Markus W. Konrad unter der Überschrift „Wandlungswege. Mystagogische Einführung in die Eucharistie" (41) - 12.30 bis 13.00 Uhr
Haus der Evangelischen Kirche, M1, 1a
„Lesung mit Gespräch" unter anderem mit Ursula Bittel und Katharina Dörnemann von der Fachstelle für Katholische Büchereiarbeit in Mainz unter der Überschrift „Atempause. Zeit zum Hören, Meditieren und Sich-Austauschen über neue und allerneuste Gedichte" - musikalische Gestaltung durch Winfried Späth von der Mainzer Cityseelsorge (324) - 14.00 bis 15.30 Uhr
Stadthaus N1, Ebene 2, Bürgersaal, N1
Podium mit Professor Dr. Stephan Goertz, Moraltheologe an der Katholischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, zum Thema „Himmlische Moral. Katholische Normenbegründung auf dem Prüfstand" (142) - 14.00 bis 15.30 Uhr
Heilig Geist, Gemeindehaus, Gemeindesaal, Moltkestraße 14
Podium mit Professor Dr. Philipp Müller, Pastoraltheologe an der Katholischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, zum Thema „Pfarrgemeinde - ein Auslaufmodell? Ein Blick auf die Zukunft von Gemeinde" (265) - 14.00 bis 15.30 Uhr
CC Rosengarten, Ebene 3, Arnold Schönberg-Hörsaal, Rosengartenplatz 2
Podium mit dem Mainzer Priester Professor Dr. Martin Stuflesser, Liturgiewissenschaftler in Würzburg, zum Thema „Wandlung. Liturgie 50 Jahre nach der Liturgiereform" (274) - 22.00 bis 0.45 Uhr
Kirche St. Aposteln, Kettelerstraße 2, Viernheim
Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Bistums Mainz bietet unter der Überschrift „Glaubensfeuer. Kirche mit allen Sinnen erleben" eine multimediale Illumination an. Jeweils zur vollen Stunde erschließen biblische Texte sowie darauf abgestimmte Licht- und Klangeffekte die Elemente Wasser, Licht und Feuer. (378)
Samstag, 19. Mai:
- 11.00 bis 12.30 Uhr
CC Rosengarten, Ebene 3, Alban Berg-Saal, Rosengartenplatz 2
Podium mit Professor Dr. Gerhard Kruip, Sozialethiker an der Katholischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, zum Thema „Verbände in der Kirche - Ort des Aufbruchs oder Denkmal?" (66) - 11.00 bis 12.30 Uhr
Ursulinen-Gymnasium, EG, Raum 16, A4,4
Vortrag und Diskussion unter anderen mit Schwester Franziska Spang von den Klarissen-Kapuzinerinnen im Kloster der Ewigen Anbetung in Mainz zum Thema „Gestalten des Aufbruchs. Klara von Assisi - selbstbestimmt glauben" (93) - 11.00 bis 12.30 Uhr
Karl Friedrich-Gymnasium, 2. OG, Raum 206, Roonstraße 4-6
Werkstatt mit Hubert Frank, Männerseelsorger im Bistum Mainz, zum Thema „Männergruppen leiten. Impulse für die Praxis" (164) - 11.00 bis 12.30 Uhr
Max Hachenburg-Schule, 2. OG, Aula, Tattersallstraße 28-30
Podium mit dem Mainzer Diözesankirchenmusikdirektor Thomas Drescher zum Thema „Kirchenmusik - Aufbruch oder Nostalgie. Perspektiven professioneller Kirchenmusik in Deutschland" (278) - 12.30 bis 13.00 Uhr
Haus der Evangelischen Kirche, M1, 1a
„Lesung mit Gespräch" unter anderem mit Ursula Bittel und Katharina Dörnemann von der Fachstelle für Katholische Büchereiarbeit in Mainz unter der Überschrift „Atempause. Zeit zum Hören, Meditieren und Sich-Austauschen über neue und allerneuste Gedichte" - musikalische Gestaltung durch Winfried Späth von der Mainzer Cityseelsorge (324) - 14.00 bis 15.30 Uhr
CC Rosengarten, Ebene 3, Gustav Mahler-Saal, Rosengartenplatz 2
Podium mit dem Mainzer Diözesanpriester, Professor Dr. Richard Hartmann, Pastoraltheologe in Fulda, zum Thema „Aufbruch wagen - Ehrenamt gestaltet Kirche. Die zukünftige Kirche wird ehrenamtlich sein oder gar nicht!" (68) - 14.00 bis 15.30 Uhr
Universität, Audimax, A3
Podium mit Dr. Hartmut Heidenreich, Direktor des Bildungswerkes der Diözese Mainz und Vorstandsmitglied der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, zum Thema „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Eltern, Schule, Erwachsenenbildung - Partner für gelingende Bildung" (80) - 14.00 bis 15.30 Uhr
Karl Friedrich-Gymnasium, 1. OG, Raum 109, Roonstraße 4-6
Bibliolog mit Andrea Schwarz aus Viernheim zum Thema „Frauen im Buch Rut wagen Ungeheuerliches. Noomi und die Schwiegertöchter Rut und Orpa brechen auf" (162) - 14.00 bis 15.30 Uhr
Popakademie, EG, Hörsaal E001, Hafenstraße 33
Podium mit Professor Dr. Hubertus Brantzen, Ausbildungsleiter für Kapläne und Pastoralreferenten im Bistum Mainz, zum Thema „Nehmt Neuland unter den Pflug (Hos 10,12). Priester werden im 21. Jahrhundert" (250) - 14.00 bis 15.30 Uhr
Tulla-Realschule, Nebengebäude, Gelbe Turnhalle, Tullastraße 25
Podium mit Dr. Frank Meessen, Leiter des Katholischen Bildungswerkes Bergstraße/Odenwald, zum Thema „Gemeinsam sind wir stark. Herausforderungen für die Ökumene in der Metropolregion" (302) - 14.00 bis 16.00 Uhr
Haus der Evangelischen Kirche, M1, 1a
„Lesung mit Gespräch" unter anderem mit Ordinariatsrat Horst Patenge, Leiter der Katholischen Fachstelle für Büchereiarbeit in Mainz, unter der Überschrift „Von Lummerland geht's himmelwärts. Schriftsteller erzählen vom Unterwegssein und vom Aufbrechen" (326) - 16.00 bis 17.30 Uhr
Tulla-Realschule, UG, Alte Turnhalle, Tullastraße 25
Podium mit dem Mainzer Priester Professor Dr. Martin Stuflesser, Liturgiewissenschaftler in Würzburg, zum Thema „Ökumenische Taufe? Was heute schon praktisch möglich ist" (303)
Ständige Angebote (Donnerstag, 17., bis Samstag, 19. Mai)
- Stand des Bistums Mainz auf der Bistumsmeile, Alter Messplatz (368)
- Stand der Weltläden Viernheim und Heppenheim unter der Überschrift „Fair ist mehr! Café im Weltladen"; Karl Friedrich-Gymnasium, UG, Raum 02, Roonstraße 4-6 (151)
- Kreativ- und Mitmachangebot von Schülern der Albertus Magnus-Schule in Viernheim zum Thema „Einen neuen Aufbruch wagen. ‚Kugeln' Sie hier zum Aufbruch der Kirche vor Ort"; Max Hachenburg-Schule, EG, Foyer, Tattersallstraße 28-30 (261)
- Pastoralreferent Hans-Georg Orthlauf-Blooß von der Regionalstelle Mainz der Betriebsseelsorge ist beim Angebot der Bundeskommission Betriebsseelsorge engagiert. Unter der Überschrift „Einparkhilfe für die Seele. Die mobile Gesellschaft - eine Herausforderung für Christen" werden Vorträge, Lesungen und „Talk im Truck" zu den Themen „Leben und Arbeiten von Fernfahrern", „Mobilität der Zukunft" sowie „Partnerschaft und Sicherheit im verkehr" angeboten; Technoseum, Vorplatz, Museumstraße 1 (285)
Musikgruppen aus dem Bistum Mainz
Außerdem werden wieder zahlreiche Gruppen und Musiker aus dem Bistum beim Katholikentag auftreten:
- Gruppe „CREscenDO" aus Weiterstadt (41, 336)
- Jugendchor Seligenstadt unter Leitung von Regionalkantor Thomas Gabriel (40)
- Junger Chor der Heilig Geist-Gemeinde in Offenbach-Rumpenheim (340)
- Band „Kreuz und quer" aus Mainz - www.band-kreuz-quer.de (46, 334)
- Christliche Liedermacherband „Laetitia" aus Obertshausen - www.laetitia.de (39, 53, 295, 337)
- Mitglieder der Pueri Cantores aus den Bistümern Freiburg, Mainz und Speyer (27)
- Band „Die Scheinheiligen" aus der Pfarrei St. Pankratius in Mainz-Hechtsheim (270, 354)
- Schönstatt-Projektband aus Mainz (175)
- Singkreis St. Aposteln aus Lampertheim (329)
- Wilfried Röhrig & Amin Jan Sayed aus Viernheim - www.wilfried-roehrig.de (41, 47, 77, 177, 335)
Hinweise:
- Das komplette, 600-seitige Programm ist als pdf-Datei auf der Internetseite des Katholikentages unter www.katholikentag.de verfügbar.
- Die Zahlen in Klammern beziehen sich jeweils auf die Seitenzahl im offiziellen Programmheft.
tob (MBN)
Malteser pilgern nach Rom (29.9.-6.10.)
Papstaudienz bei Wallfahrt für Menschen mit Behinderung
Mainz. Die Malteser Mainz bieten eine betreute Wallfahrt für kranke und behinderte Menschen nach Rom an: Vom 29. September bis 6. Oktober macht sich ein Team aus Ärzten, Pflegekräften und Malteser Helfern gemeinsam mit den Pilgern auf den Weg in die Ewige Stadt. Höhepunkte der Reise sind eine Papstaudienz, die Besichtigung des Petersdoms sowie Gottesdienste in den Hauptkirchen Roms. Interessierte können sich ab sofort bei den Maltesern für die Pilgerfahrt anmelden.
Bereits zum zehnten Mal findet die Malteser Romwallfahrt für Kranke und Behinderte statt, dieses Jahr unter dem Motto „Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch". „Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind oder intensiver Pflege und Betreuung bedürfen, könnten ohne Hilfe die Reise nach Rom nicht machen", erklärt Markus Schips, Geschäftsführer der Malteser in der Diözese Mainz. „Durch unser großes Team an freiwilligen Helfer ermöglichen wir kranken und behinderten Pilgern die Teilnahme an der Wallfahrt."
Ehrenamtliche Helfer betreuen die Pilger von der Abfahrt bis zur Heimkunft. Darüber hinaus begleiten Ärzte, Pflegepersonal und Priester die Gruppe. In einem Vorgespräch nehmen die Malteser die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse auf, sodass sie während der Reise für jeden einzelnen Pilger eine individuelle Betreuung und medizinische Versorgung sicherstellen können.
Die Kosten betragen 850 Euro pro Person. Darin enthalten sind die Hin- und Rückfahrt mit einem behindertengerechten Reisebus, die Unterkunft und Vollpension, alle Besichtigungen sowie eine intensive Betreuung und Begleitung durch die Malteser.
Hinweis: Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 06131/2858320, E-Mail markus.schips@malteser.org, Internet: www.malteser-mainz.de
ng (MBN)
Personalien
Clemens Breitschaft wird Domchordirektor in Osnabrück
Der 31-jährige tritt die Nachfolge des langjährigen Leiters Johannes Rahe an
Osnabrück/Mainz. Clemens Breitschaft, Sohn des Mainzer Domkapellmeisters Mathias Breitschaft, wird ab 1. August neuer Domchordirektor in Osnabrück. Das gab die Pressestelle des Bistums Osnabrück am Donnerstag, 5. April bekannt. Breitschaft ist seit 2009 Chorassistent beim Domchor Osnabrück und Osnabrücker Jugendchor. Der 31-Jährige tritt die Nachfolger von Johannes Rahe an, der Mitte Mai nach 33 Jahren als Leiter der Osnabrücker Domchöre in den Ruhestand geht. Breitschaft stammt gebürtig aus dem hessischen Hadamar, wuchs in Mainz auf und studierte in Frankfurt Schulmusik und Chordirigieren. Bevor er nach Osnabrück kam, leitete er bereits mehrere Chöre, wirkte als Sänger in verschiedenen Ensembles in Deutschland mit und trat als Bass-Solist auf.
am (MBN)
Berichte
Eine neue Lebensqualität
Predigt von Weihbischof Neymeyr in der Osternacht
Mainz. Der Mainzer Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr hat darauf hingewiesen, dass im Bistum Mainz jährlich rund 200 Erwachsene getauft werden. „Die 15 Erwachsenen, die ich im Mainzer Dom als Taufbewerber aufgenommen habe, werden heute in ihren Gemeinden in der Osternacht getauft. Sie sind auf der Suche nach einer besonderen Lebensqualität", sagte Neymeyr in seiner Predigt in der Feier der Osternacht am Samstag, 7. April, im Mainzer Dom.
Die Begegnung mit diesen Menschen hätten ihn „sehr beeindruckt", sagte der Weihbischof weiter. „Sie folgen ja nicht nur einer momentanen Anwandlung, in der sie hin und wieder an einem christlichen Gottesdienst teilnehmen, sondern sie lassen sich auf unseren christlichen Glauben ganz neu, aber auch sehr umfassend ein. Es ist ihnen dabei deutlich geworden, dass sie mit der Taufe nicht nur den christlichen Glauben für sich akzeptieren, dass also die Taufe nicht nur ihre Entscheidung und ihr Tun ist, sondern dass in der Taufe Jesus Christus auf sie zukommt, dass er sie einbezieht in sein Erlösungswerk", unterstrich er.
Neymeyr betonte, dass die Verbindung mit Jesus Christus „unserem Leben in der Tat eine neue Lebensqualität" gebe, „mit der wir uns nicht zu verstecken brauchen". „Gerade in den persönlichen Beziehungen, die unser Leben tragen, müssen wir nicht verschweigen, was uns der Glaube an Christus im Inneren bedeutet. Bei der Feier der Aufnahme der erwachsenen Taufbewerber haben mich nicht nur die Taufbewerber beeindruckt, sondern auch ihre katholischen Partnerinnen und Partner, die ihren Glauben nicht versteckt, sondern hingehalten haben", sagte er.
am (MBN)
Dokumentationen
Jesus Christus, unser Leben
Predigt von Kardinal Karl Lehmann am Ostersonntag
Mainz. Anlässlich des Osterfestes am Sonntag, 8. April, hat der Bischof von Mainz, Kardinal Karl Lehmann, ein festliches Pontifikalamt im Mainzer Dom gefeiert. Im Folgenden dokumentieren wir den Text der Predigt:
Lesung: Kol 3,1-4
„Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit"
Es ist schon merkwürdig, wie der Brief an die Kolosser in der Lesung, die wir gehört haben, vom Schicksal Jesu Christi spricht. Dadurch wird das Wort von der Auferstehung gedeutet. Denn zunächst ist ja der Tod Jesu Christi am Kreuz die schändlichste Hinrichtungsart der Alten Welt. Ein römischer Bürger durfte zum Beispiel nicht gekreuzigt werden. Vor allem Kriminelle wurden auf diese grausame Art getötet. Wie kann man nun im selben Atemzug erklären, dass Jesus Christus „unser Leben" ist?
Es gibt ähnliche Redeweisen im Neuen Testament und auch bei den ersten Zeugen des frühen Christentums. Sogar aus dem Gefängnis schreibt Paulus: „Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn." (Phil 1,21) - „Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht." (1 Joh 5,12) In den frühen Briefen des heiligen Igantius von Antiochien können wir ähnliches lesen (zum Beispiel Eph 7,2; Smyrn 4,1; Magn 1,2). Aber natürlich wird uns im Johannesevangelium besonders ausdrücklich gesagt, dass Jesus das Leben ist (vgl. 11,25; 14,6). Freilich ist bei Johannes der Akzent etwas verschoben, wenn dieser formuliert, er ist nämlich das Leben, weil er „von oben", von Gott kommt und weil er das Leben gibt (vgl. 3,11-17; 14,19). Es ist auch gegenwärtiges Leben (vgl. 3,15f. 36), das eine unbeschränkte Zukunft erwarten darf (4,14; 6,27; 12,25). Aber die Auferstehung bzw. Erhöhung tritt im Unterschied zu Aussagen beim heiligen Paulus etwas zurück. All dies ist vergleichbar mit anderen Heilsgütern, mit denen Jesus gleichgesetzt wird: Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung, Geist, Friede, Hoffnung, Auferstehung und Leben (vgl. 1 Kor 1,30; 2 Kor 2,17; Eph 2,14; Kol 1,27; 1 Tim 1,1). Aber die Rede „vom Leben" hat doch einen bleibenden Vorrang.
Das Leben und Sterben Jesu hat unsere gewöhnlichen Anschauungen verändert. Was einst war, das gilt nun nicht mehr (vgl. Kol 3,3). Das alte Leben ist ein für allemal durch den Tod abgetan. Bestimmende Wirklichkeit ist allein das Leben, das uns durch Gottes schöpferische Macht zuteil geworden ist, ähnlich wie bei der Erschaffung aus dem Nichts. Das Leben, das durch den Tod hindurchgegangen ist, kann nun nicht mehr durch den üblichen Tod des Menschen völlig aufgehoben werden. Damit ist auch das Leben neu geschaffen, wie wir im IV. Hochgebet sprechen.
Jesu Leben hat sich in einer geradezu paradoxen Weise bewährt. Am deutlichsten sagt es wohl Jesu Rede vom Weizenkorn, das ausgesät wird. „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben." (Joh 12,24f.) Das Leben, das sich besonders für andere hingibt, wird nicht durch die Gewalt der Menschen ausgelöscht, sondern es wird zu einer neuen Kraft verwandelt. Nur darum kann Paulus auch sagen, dass der leidende und getötete Herr „unser Leben" ist.
Die frühe Christenheit hat mit einem solchen Wort auch schwierige Erfahrungen gemacht. Es gab nämlich Menschen, die mit dem Christentum in Berührung kamen, aber doch auch anderen Einflüssen unterlegen sind. Dort herrschte die Vorstellung vor, als wäre das Heil in ungebrochener Fülle sichtbar vorhanden, der Tod sei bereits verschwunden und die Auferstehung der Toten sei bereits geschehen (vgl. z. B. 2 Tim 2,18). Paulus spricht an dieser Stelle sehr vorsichtig. Er sagt an keiner Stelle, die Christen seien bereits mit Jesus Christus auferstanden. Der Christ ist mit Jesus Christus gestorben und geht der künftigen Auferstehung entgegen. Jede schwärmerische Ausdeutung wird ausgeschlossen. Aber deswegen wird nicht geleugnet, dass das Leben durch die Auferstehung Jesu Christi neu geschaffen wurde. Die alte Vergangenheit hat keinen Anspruch mehr. Das Leben, das Gott in der Auferstehung mit Jesus Christus geschaffen hat, bleibt deshalb freilich ganz an ihn gebunden. Es kann nicht einfach greifbar vorgewiesen werden. Es ist eine Gabe, die im Glauben und in der Hoffnung vom Getauften empfangen wird.
An dieser Stelle wird der Kolosserbrief im engen Anschluss an Paulus sehr deutlich, dass das Leben mit Jesus Christus in Gott verborgen ist. Dies ist eine Kernaussage von der Auferstehung. Sie verhindert jeden falschen Jubel. Dies hat zur Konsequenz, dass Leib und Leiden nicht einfach aus unserer Welt verschwunden sind. Sie haben noch ihre Macht und können auch den Christen in höchsten Maß anfechten, besonders wenn er die Macht der Sünde, zumal der Ungerechtigkeit und der Gewalt, oder die zerstörerische Macht von Krankheit und Sterben erfährt. Aber mitten in dieser gegenwärtigen Unheilssituation wird uns durch das Evangelium doch die Gewissheit und damit auch der Trost geschenkt, dass das endzeitliche Heil unsere Welt schon ergriffen hat, auch wenn wir noch seufzen und klagen. Leiden und Tod werden nicht einfach zum Verschwinden gebracht, auch der auferstandene Herr mahnt uns durch die Wundmale an seinem Leib, dass wir sein Geschick nicht vergessen.
Darum spricht der heilige Paulus auch von der „Neuheit des Lebens" (Röm 6,4), in der wir unser Leben verbringen und vollziehen sollen. Erst wenn Jesus Christus ganz offenbar wird, wird auch unsere Auferstehung mit ihm ganz in Erscheinung treten, oder wie der Kolosserbrief sagt: „Dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dann ist die Herrlichkeit vollendet und bleibt. Deshalb kommt auch in dieser Zeit nun alles darauf an, dass wir dem neuen Leben entsprechen, es in unserer eigenen Existenz bezeugen und - wenn auch bruchstückhaft und unvollkommen - in unserem Handeln verwirklichen. Dies geschieht auf vielfache Weise. Es geht zuerst zum Beispiel um das Festhalten am Evangelium und um die Bewährung des Glaubens im täglichen Leben. Ganz gewiss ist damit an erster Stelle auch die Treue im Glauben gemeint, und zwar gegenüber aller Anfeindung, aller Bedrohung und auch der Armut. Paulus meint diese konkreten Leidenserfahrungen (vgl. 1 Thess 2,14; Röm 8,35; 2 Kor 8,13; Röm 8,35). Der Glaubende weiß bei aller Bedrängnis, dass ihn nichts von der Liebe trennen kann (vgl. Röm 8,35.39).
Deswegen gibt es durchaus, wenn auch immer in verhaltener Weise, einen echten Jubel über den Ostersieg Jesu Christi. Das neue Leben ist gegenwärtig auch erfahrbar in der Praxis der Solidarität (vgl. Röm 14 und 15). Besonders die johanneischen Schriften sehen dies in der Nächstenliebe verwirklicht und erinnern uns mahnend immer daran, dass sich hier der Übergang vom Tod zum Leben vollzieht. „Wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht; da gibt es für ihn kein Straucheln. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Er geht in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht; denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht." (1 Joh 2,9-11) Darum erblickt die johanneische Theologie auch die Vollendung des Glaubens in der Liebe (vgl. 1 Joh 4,7ff.).
Ostern gibt uns den Grund von Glaube, Hoffnung und Liebe. Der heilige Paulus lässt keinen Zweifel, auf welchem Fundament wir stehen. „Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos ... Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos ... Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen." (1 Kor 15,14.17-19) Wir erfahren immer wieder diesen Zwiespalt in unserem eigenen Herzen und in unserem Leben in der Welt. Deswegen gibt es aber auch den ständigen Kampf zwischen dem Verständnis eines Lebens, das sich in unserer Zeit und Welt erschöpft, und einem Leben, das uns durch Jesus Christus neu geschenkt wird. Ostern zeigt uns, wer das Licht des Lebens ist und wie wir durch alle Anfechtungen hindurch auf Jesus Christus als „unser Leben" setzen dürfen. Amen.
(MBN)
„Durch Leiden den Gehorsam gelernt"
Predigt von Kardinal Lehmann im Pontifikalgottesdienst am Karfreitag
Mainz. Der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, hat am Karfreitag, 6. April, der Karfreitagsliturgie im Mainzer Dom vorgestanden. Im Folgenden dokumentieren wir den Predigttext des Kardinals:
Sehr verehrte, liebe Schwestern und Brüder im Herrn!
Im Vordergrund des heutigen Gottesdienstes, der ja keine Eucharistiefeier darstellt, steht die Passion Jesu Christi nach dem Evangelisten Johannes. Jesus liefert sich nach dieser Leidensgeschichte mit klarem Wissen freiwillig dem Tod aus. Deswegen steht er auch souverän seinen Anklägern und Richtern gegenüber. Niemand kann ihm letztlich sein Leben entreißen, er gibt es selbst hin.
Vor diesem Hintergrund möchte ich die zweite Lesung dieses Gottesdienstes aus dem Hebräerbrief (4,14-16; 5,7-9) zum Anlass nehmen, um die Lebenshingabe Jesu für uns zu erhellen. Der Hebräerbrief wird dabei von uns oft in seiner Bedeutung unterschätzt. Er ist nicht leicht zu verstehen, aber deswegen dürfen wir nicht auf seine tiefe Betrachtung des Leidens und Sterbens Jesu verzichten.
Abgesehen von den Evangelien und der Apostelgeschichte wird nirgends im Neuen Testament so häufig einfach der Name Jesus verwendet wie im Hebräerbrief. Damit wird weniger der so genannte historische Jesus angezielt. Vielmehr will der Verfasser dieses großen theologischen Briefes die Bedeutung des Menschseins Jesu als Teil des Heilsgeschehens und als Inhalt unseres Glaubens herausstellen. Es geht darum, dass „der Sohn", wie es oft und gerne heißt, bis in Anfechtungen und dem Erleiden des Todes hinein uns sterblichen Menschen gleich geworden ist, mit Ausnahme der Sünde. Seine jetzige Stellung zur Rechten des Vaters, wo er an der Herrschaft Gottes teilhat, führt über dieses Gleichwerden mit den Seinen. Es ist erstaunlich, wie oft der Brief davon redet. Einige Beispiele: „Er hat in gleicher Weise wie wir Fleisch und Blut angenommen." (2,14) „Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott zu sein." (2,17) Oder auch: „Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden." Und aus unserer heutigen Lesung: „Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat." (4,15) Zu einem gewissen Höhepunkt kommt der Brief im fünften Kapitel, wo es von Jesus heißt: „Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist." (5,2) Schließlich heißt es gerade im Blick auf das Leiden und Sterben Jesu, also den Karfreitag: „Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhöht und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden." (5,7-9) Man könnte die Zeugnisse noch vermehren.
Im Hebräerbrief wird also nicht nur allgemein von der Menschwerdung des Sohnes geredet, sondern er ist gerade auch im Leiden, in den Anfechtungen, ja selbst in den Versuchungen und in seinem Sterben uns - der Text scheut sich nicht das zu sagen - gleich geworden. Dies darf uns nicht durch bald 2.000 Jahre Spiritualität und Theologie zu selbstverständlich sein. Auch Jesus hat „mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte". Von Angst ist die Rede. Er hat so sehr das Leben von uns Menschen angenommen, dass die Schrift von ihm sagen konnte: „Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt." Nur dadurch, dass er die Erniedrigung des Menschen bis zur Neige, ja bis zum bitteren Ende ausgelitten hat, ist er vollendet. Mit Bedacht verwendet der Hebräerbrief das Wort „Vollendung" gerade im Hinblick auf das Gleichwerden mit uns Menschen in den vielen Bitterkeiten des Lebens. Gerade in Situationen der Anfechtung bleibt Jesus uns nahe. Er kennt den Menschen von innen und von außen her.
Dies passt sehr genau zu der Gemeinde von damals und heute. Die Gemeinde ist nach der Begeisterung des Anfangs müde geworden. Sie hat in sich selbst viele Probleme. Der zuerst gefeierte Glaube wird gefährdet. Aber gerade so ist Jesus seiner Gemeinde nahe. Die akute Gefährdung des Glaubens wird eng zusammengebracht mit der Situation des erniedrigten Sohnes, des Menschen Jesus, der in allem seinen Brüdern gleich ist. Weil er uns auch in den Versuchungen kennt, kann er uns helfen. Dies gilt nicht nur für das Leiden und den Tod, nicht nur für die bekannten Versuchungen des Menschen nach Reichtum, Ehre, Macht und Lust, sondern es gilt auch für aufkommende Zweifel, die Anfechtungen bei Angriffen, beim Eingeständnis erbärmlicher Schuld und bei der enttäuschenden „Müdigkeit der Guten". Darum ist Jesus auch in der heutigen Situation der Kirche, die vielfach angefochten ist, wie damals bei uns. Obgleich er „in allem wie wir in Versuchung geführt" wurde, ist er vom Bösen nicht besiegt worden. Darum fordert uns der Hebräerbrief auf, dass wir uns in allen Situationen zu Jesus bekennen sollen (vgl. 3,1; 4,14; 10,23) und dass wir deshalb auch am Bekenntnis zu ihm festhalten sollen (vgl. außerdem 2,9; 12,2; 3,14; 6,11f.; 10,35f.; 11,1; 12,1). Der Weg Jesu kann auch der Weg der Gemeinde werden.
Zwei Dinge empfiehlt uns dabei der Hebräerbrief - gerade im Blick auf die Urgefahren des Glaubens und des Menschen -, nämlich wir sollten Zuversicht und Ausdauer haben. Auch dies können wir im Blick auf das Kreuz von Jesus lernen. Er ist das Heil der Welt. Amen.
(MBN)