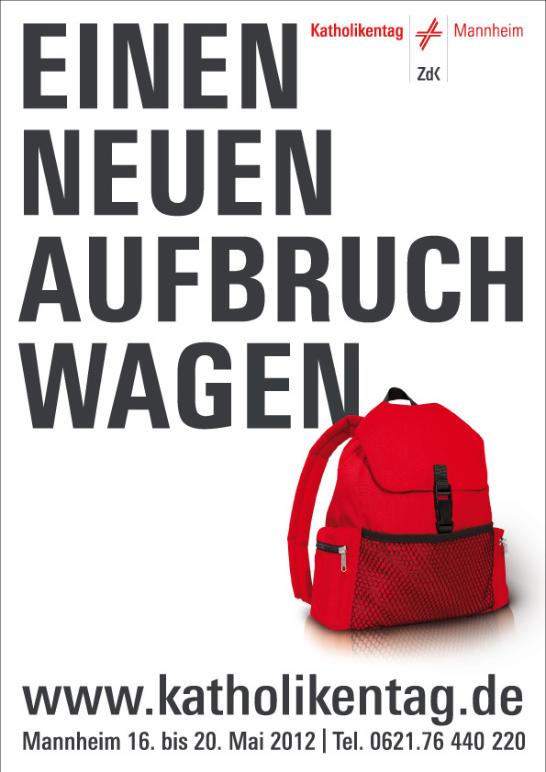Berichte
Orden gaben „Antworten auf Fragen der Zeit"
64. Jahrestagung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte
Mainz. Nach den Worten des Kirchenhistorikers Professor Dr. Joachim Schmiedl, Vallendar, Dekan der Hochschule und Präsident der deutschen Sektion der Gesellschaft für Europäische Theologie, spiegeln die Ordensgemeinschaften in allen Epochen die Probleme und Chancen der Kirche wider. Er hielt am Donnerstagabend, 12. April, in Mainz den Eröffnungsvortrag zur 64. Jahrestagung der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte zum Thema „Wandel oder Ende einer Lebensform? Orden und Kongregationen im Bistum Mainz im 19. und 20. Jahrhundert". Er verwies darauf, dass es in den 1950er und 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts noch häufig „Erfolgsgeschichten" gab, aber heute meist nur noch Berichte über Schließungen von Ordenshäusern in der Presse zu lesen seien.
Den enormen Rückgang des klösterlichen Lebens belegte Schmiedl mit umfassenden statistischen Material. Daraus ging unter anderem hervor, dass die Zahl der Ordensschwestern in Deutschland von 90.000 im Jahr 1960 auf zurzeit 20.000 gesunken ist, von denen 80 Prozent älter als 65 Jahre seien. Hatte es um 1960 noch rund 23.000 Eintritte pro Jahr in Deutschland gegeben, so seien es heute nur noch 100. Jedes Jahr sinke die Zahl der Ordensfrauen um weitere 1.000. Die jungen Schwestern, die aus anderen Ländern und Erdteilen nach Deutschland kommen, könnten diesen Verlust nur teilweise ausgleichen, stellte er fest und erklärte: „Die Orden, die sich als christliche Avantgarde verstehen, werden mehr und mehr zur Avantgarde der Krise." Positive Zeichen sieht Schmiedl im Engagement kleinerer Gruppen, die spezielle Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel die aus den USA gekommenen Barmherzigen Schwestern von Alma in Mainz. Ein „kreativer Neuanfang" brauche allerdings einen langen Atem.
Förderung der Orden durch Bischof Ketteler
Ein besonderes Augenmerk lenkte Schmiedl auf das Wirken von Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler, der, gestützt vom „katholischen Milieu", das Ordensleben zu einer neuen Blüte geführt habe, trotz des Kahlschlags durch die Säkularisation, trotz der Restriktionen durch die staatlichen Behörden und der kirchenfeindlichen Kulturkampfgesetze. Ketteler habe diese wiederholt scharf kritisiert, und gegen die „unerträgliche Unduldsamkeit" protestiert, die die staatsbürgerliche Freiheit außer Kraft setze, zugleich auf das segensreiche Wirken der Schwestern in Erziehung, Bildung und Krankenpflege hingewiesen und gefordert, für Orden dürfe es keine Ausnahmegesetze geben. „Es gab nicht viele Bischöfe, die sich so für die Orden einsetzt haben wie Ketteler", unterstrich Schmiedl, was Kardinal Karl Lehmann, Bischof von Mainz, der an der Eröffnung der Tagung teilnahm, in einem Diskussionsbeitrag nachdrücklich bekräftigte. Darüber hinaus verwies Schmiedl auch auf die Erklärungen des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Würzburger Synode, die wegen ihres Weitblicks stärker beachtet werden sollten.
Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen in der Bistumsakadamie Erbacher Hof stand die Frage, welche „Antworten" die Orden im (Erz-)Bistum Mainz in den verschiedenen Epochen jeweils auf „Fragen der Zeit" gegeben haben, und welche Antworten heute erforderlich seien, wie der Moderator der wissenschaftlichen Tagung, der Mainzer Kirchenhistoriker Professor Dr. Johannes Meier, immer wieder in Erinnerung rief. Das Thema gehöre seit über 30 Jahren zu den primären Interessen des von Pater Professor Dr. Friedhelm Jürgensmeier MSF initiierten, und seit der Gründung durch das Bistum Mainz im Jahr 1980 von ihm geleiteten Instituts für Mainzer Kirchengeschichte, unterstrich Meier. Er verwies darauf, dass im Hochmittelalter die Hälfte der Päpste Mönche waren und dass in der Neuzeit der Benediktiner Pius VII. (1800-1822) und der Kamaldulenzer Gregor XVI. (1831-1846) die letzten Päpste waren, die einem Orden angehörten. Die wechselseitige Nähe vieler Klöster zum Papsttum verdeutliche der Präsident der Monumenta Germaniae Historica, Professor Dr. Rudolf Schieffer, München, im öffentlichen Festvortrag zum Thema „Geschmückt mit Privilegien des Apostolischen Stuhls. Die Rombeziehungen der Klöster und Stifte des Mainzer Erzbistums bis gegen 1200". Maßstab für alle Klosterprivilegien war das „Zacharias-Privileg" von 751, mit dem Papst Zacharias das von Bonifatius gegründete Kloster Fulda dem Papst unmittelbar unterstellte und mit besonderen Freiheiten ausstattete. Schieffer stellte klar, dass die Päpste keine materiellen Güter zu verschenken hatten, sondern nur Schenkungen Dritter bestätigen konnten. Warum die Klöster in der Stadt Mainz vergleichweise dürftig mit Privilegien ausgestattet waren, blieb letztlich offen. Im Vordergrund stand das Bestreben, mit den Würdezeichen des Apostolischen Stuhles geschmückt zu werden, unterstrich Schieffer.
Erstaunliche Blüte der Kartäuser im 14. Jahrhundert
Über die erstaunliche Ausbreitung der Kartäuser rund 300 Jahre nach der Ordensgründung berichtete Privatdozent Dr. Michael Oberweis unter der Überschrift „Ein alter Orden in neuer Umgebung". Als die im Erzbistum Mainz noch nahezu unbekannten Mönche im Rheingau nicht Fuß fassen konnten, stiftete ihr großer Förderer, Erzbischof Peter von Aspelt, 1320 die Mainzer Kartause. Dieser Impuls habe eine Welle von rund 100 Neugründungen ausgelöst, so dass man das 14. Jahrhundert als das „kartäusische" bezeichnen könne, stellte Oberweis fest. Der Erzbischof erhoffte sich von den Kartäusern ein Wachstum an Frömmigkeit in der Bevölkerung, Durch ihre Schreibtätigkeit, ihr „Predigen mit den Händen" und die Verbreitung von Erbauungsschriften auch für Laien sowie neuer Frömmigkeitsformen der „Devotio moderna" seien sie diesem Anspruch gerecht geworden.
Weitere Vorträge waren besonderen Krisenzeiten für das Ordensleben gewidmet, in denen zahlreiche, vormals blühende Klöster aufgelöst wurden. Der Niedergang der Franziskaner (Neuer Orden - Neue Wege?", Dr. Christian Plath, Verden) begann in der Zeit der Reformation. Auch die Benediktinerinnen und Benediktiner standen „im Spannungsfeld von Reform und Reformation" (Dr. Elke-Ursel Hammer, Koblenz). Schließlich ließ die „Aufgeklärte Ordenspolitik in Kurmainz" (Sascha Weber, Mainz) in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Klöstern kaum noch Entfaltungsmöglichkeiten.
Die große Bedeutung, die die Prämonstratenser im Mainzer Erzbistum gewannen, schilderte Dr. Ingrid Ehlers-Kisseler, Bad Nauheim, die ausgehend vom 1123 in Ilbenstadt gegründeten Kloster mehrere „Gründungswellen" durch Angehörige des Adels darlegte. Dies wurde in der abschließenden Exkursion der Tagungsteilnehmer nach Ilbenstadt anschaulich. In der dortigen Basilika, der Grabeskirche des Klostergründers, des heiligen Gottfried von Cappenberg, feierte der Mainzer Vizepräsident der Gesellschaft, Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr, mit den Tagungsteilnehmer einen Gottesdienst. Weitere Stationen der Exkursion in die Wetterau waren das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Marienschloss in Rockenberg und die Hospitalkapelle der Johanniter-Kommende in Nieder-Weisel aus dem 13. Jahrhundert.
Ehrungen
Der Präsident der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, Professor Dr. Peter Walter, Freiburg, verlieh im Rahmen der Tagung vom 12. bis 14. April Professor Dr. Wolfgang Seibrich, Trier, und Studiendirektorin Regina Elisabeth Schwerdtfeger vom Institut für Mainzer Kirchengeschichte die Plakette für besondere Verdienste um die von den Bistümern Fulda, Limburg, Mainz, Speyer, Trier und Erfurt getragene Gesellschaft.
Sk (MBN)
„Rock war Henkerslohn, den Jesus bezahlen musste"
Das Bistum Mainz pilgerte mit Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr nach Trier
Trier/Mainz. „Der Heilige Rock mahnt uns zur Dankbarkeit für die Erlösung." Das sagte der Mainzer Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr in einem Gottesdienst zur Heilig-Rock-Wallfahrt des Bistums Mainz. Die Messe in der Trierer Jesuitenkirche am Sonntag, 15. April, mit etwa 100 Gläubigen und 50 Mitgliedern des Mädchenchors am Dom und St. Quintin Mainz zelebrierte er gemeinsam mit dem Mainzer Domdekan, Prälat Heinz Heckwolf, und dem Trierer Weihbischof Robert Brahm. Insgesamt waren 250 Pilger aus dem Bistum Mainz zur Wallfahrt angemeldet.
Der Heilige Rock, der in Trier verehrt werde und um den die Soldaten das Los geworfen hätten, sei der Henkerslohn gewesen, den Jesus für seine Hinrichtung hätte bezahlen müssen, sagte der Weihbischof in seiner Predigt. Das werfe ein erschreckend konkretes und realistisches Bild auf die Passion Jesu. Der Heilige Rock bezeuge zudem, dass Jesus nicht nur seiner Kleider beraubt, sondern auch enteignet worden sei. Denn mit der Hinrichtung sei im Römischen Reich die Enteignung verbunden gewesen. „Da Jesus buchstäblich nur seine Kleider besaß, und es bei ihm nichts mehr zu enteignen gab, wurden die Soldaten eben mit den Kleidern entschädigt", sagte Neymeyr.
Am Kreuz sei Jesus nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, nämlich seines Gottesglaubens, enteignet worden, betonte der Weihbischof mit Bezug auf Psalm 22: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" „Dass wir hier seinen letzten Rock verehren, bedeutet für uns, die Zumutung dieses Schicksals an uns heranzulassen. Wir erahnen darin das Geheimnis der Erlösung", sagte Neymeyr. „Der Heilige Rock mahnt uns dazu, unserer eigenen Erlösungsbedürftigkeit nachzugehen, sie nicht zu verdrängen, sondern uns ihr zu stellen und uns hineinzugeben in das Erlösungswerk Jesu Christi", unterstrich er.
Nach dem Gottesdienst zog die Mainzer Bistumsgruppe zum Trierer Dom, um den Heiligen Rock zu verehren. Die Pilgergruppen kamen unter anderem aus der Pfarrgruppe Alsfeld-Homberg sowie aus der Pfarrgruppe Sprendlingen.
pm (MBN)
Keine Zukunft ohne Erinnerung
Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer des Völkermordes in Ruanda
Bingen. Die Toten des Genozids in Runada können nicht einfach vergessen werden, sagte der Mainzer Generalvikar, Prälat Dietmar Giebelmann, am Dienstag, 17. April, bei einem ökumenischen Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer des Völkermordes 1994 in Ruanda. Wörtlich sagte er: „Aus dem Versuch der Vergebung kann eine Erinnerung werden, die nicht Hass ist, die nicht nach Vergeltung brüllt, sondern eine Erinnerung, die mahnt: niemals wieder! Weil der Mensch nicht von seiner Herkunft, seiner Abstammung und seines Stammes her bestimmt ist, sondern von seiner Würde, die er für uns als Christen von Gott her hat." Der Gottesdienst in der Basilika St. Martin in Bingen war in diesem Jahr vom Stefan George-Gymnasium in Bingen veranstaltet worden.
tob (MBN)
Vorverkaufsstellen für den Katholikentag
Im Mainzer Infoladen und an vier weiteren Stellen im Bistum gibt es Karten
Mainz/Mannheim. Bereits Mitte April hat sich der 25.000 Dauerteilnehmer für den Mannheimer Katholikentag (16.-20. Mai) angemeldet, wie die Geschäftsstelle jetzt mitgeteilt hat. Außerdem werden zu dem Treffen, das vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in der Regel alle zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet wird, rund 30.000 Tagessgäste aus der Region erwartet. Vorverkaufskarten gibt es im Bistum Mainz unter anderem im Infoladen der Diözese. Die Karten können nur persönlich im Laden erworben werden; sie können nicht bestellt oder telefonisch geordert werden. Bei allen Vorverkaufsstellen ist EC-Karten-Zahlung möglich.
Es gibt Karten in folgenden Kategorien:
- Dauerkarte: 79 Euro einschließlich Tagungsmappe, Schlüsselband, Fahrausweis und Ausweishülle
- Ermäßigte Dauerkarte: 59 Euro einschließlich Tagungsmappe, Schlüsselband, Fahrausweis und Ausweishülle
- Tageskarte für Donnerstag, Freitag oder Samstag: 25 Euro mit Fahrausweis, ohne Tagungsmappe, kein Quartieranspruch
- Ermäßigte Tageskarte für Donnerstag, Freitag oder Samstag: 20 Euro mit Fahrausweis, ohne Tagungsmappe, kein Quartieranspruch
- Abendkarte für Donnerstag, Freitag oder Samstag: 15 Euro ohne Tagungsmappe, mit Fahrausweis, kein Quartieranspruch; gültig ab 16.00 Uhr
- Zusätzliche Tagungsmappen können zum Preis von fünf Euro erworben werden
Ermäßigungen werden gewährt für:
- Teilnehmende bis einschließlich 25 Jahre
- Menschen mit Behinderung
- Grundsicherungsempfängerinnen und -empfänger
- ALG-II-Bezieherinnen und -bezieher
- Freiwilligendienstleistende
- Studierende
- Rentnerinnen und Rentner (wenn es deren wirtschaftliche Lage erfordert)
Die Vorverkaufsstellen im Bistum Mainz:
Infoladen Mainz
Mo. bis Fr. 10.30 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, Sa. 10.30 bis 14.00 Uhr
Heiliggrabgasse 8 (Ecke Augustinerstraße)
55116 Mainz
Tel.: 06131/253-888
Südhessen Morgen in Bürstadt
Mo., Di., Do. 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.15 bis 17.00 Uhr, Mi. 8.30 bis 12.30 Uhr
Nibelungenstr. 40
64625 Bürstadt
Bergsträßer Anzeiger in Bensheim
Mo. bis Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr, Sa. 8.00 bis 12.00 Uhr
Rodensteinstr. 6
64625 Bensheim
Alpha Buchhandlung in Worms
Mo., Di., Do., Fr. 9.30 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr,
Mi. und Sa. 9.30 bis 13.00 Uhr
Wielandstr. 12
67547 Worms
Tel.: 06241/44982
Eine-Welt-Laden in Viernheim
Mo. bis Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
Rathausstraße 32
68519 Viernheim
Tel. 06204/6106752
Hinweis: www.katholikentag.de
tob (MBN)
Blänsdorf: „Ein großes Stück Bildungs- und Schriftgeschichte"
Ausstellung mit Pergamentfragmenten in der Mainzer Martinus-Bibliothek
Mainz. „Griechen - Römer - Araber in Pergament-Fragmenten der Martinus-Bibliothek" heißt die neue Ausstellung der Wissenschaftlichen Diözesanbibliothek des Bistums Mainz. Ab Mittwoch, 18. April, werden 17 repräsentative Fragmente von Handschriften aus der Zeit zwischen dem neunten und 14. Jahrhundert gezeigt, die in den letzten Jahren in der Martinus-Bibliothek wiederentdeckt worden sind. Die Ausstellung ermöglicht einerseits einen Blick auf die Welt des mittelalterlichen Wissens; zum anderen gibt sie auch Einblicke in die paläografische Forschung, indem sie etwa darstellt, wie ein mittelalterliches Manuskript entziffert wird.
Das Besondere an den Fragmenten aus der Martinus-Bibliothek sei „das außerordentlich weite Spektrum nach Zeit und Herkunft der Texte", sagte der Mainzer Altphilologe Professor Dr. Jürgen Blänsdorf. Vor Journalisten wies er am Montag, 16. April, darauf hin, dass die Fragmente aus der Zeit vom vierten Jahrhundert vor Christus bis ins 15. Jahrhundert reichten und damit „ein großes Stück Bildungs- und Schriftgeschichte darstellen". Eine weitere Besonderheit sei, dass die Fragmente der entdeckten Aristoteles-Texte eine etwa 100 Jahre ältere Textstufe böten als die bekannten lateinischen Übersetzungen von Wilhelm von Moerbeke (etwa 1215-1286). Professor Blänsdorf und Dr. Helmut Hinkel, Direktor der Martinus-Bibliothek, sind Kuratoren der Ausstellung.
Die Pergament-Codices waren ab dem Ende des 15. Jahrhunderts mit dem Aufkommen des Buchdrucks zerschnitten und als Einbandhilfe für Inkunabeln verwendet worden. Dabei sei keinerlei Rücksicht auf den Inhalt genommen worden, sagte Blänsdorf. Teilweise wurden ganze Blätter mit bis zu acht Seiten gefunden. Durch diese Fragmente erhält die Forschung einen guten Einblick in die literarischen, theologischen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Interessen des Mittelalters.
Eröffnungsvortrag von Professor Blänsdorf (17.4.)
Zu der Ausstellung, die - bei freiem Eintritt - bis zum 27. Juli gezeigt wird, ist eine 132-seitige Publikation von Professor Blänsdorf mit dem Titel „Die wiedergefundene Bibliothek" erschienen. Der renommierte Mainzer Altphilologe wird bei der Vernissage am Dienstag, 17. April, um 18.15 Uhr den Einführungsvortrag in der Martinus-Bibliothek halten.
Der Direktor der Martinus-Bibliothek, Dr. Helmut Hinkel, wies bei der Pressekonferenz darauf hin, dass ein großer Teil der Funde der Arbeit des Mainzer Buchwissenschaftlers Dr. Franz Stephan Pelgen zu verdanken sei. Pelgen rekonstruiert für sein DFG-Projekt über den Wormser Weihbischof Stephan Alexander Würdtwein (1719-1796) dessen Gelehrtenbibliothek. Rund 800 Bände davon befinden sich in der Martinus-Bibliothek. Bei seiner Arbeit habe er rund 30.000 Bände aus der Martinus-Bibliothek für seine Forschungen in der Hand gehabt und rund 230 Fragmente entdeckt. Insgesamt besitzt die Bibliothek rund 300 Handschriften.
Dr. Christoph Winterer vom Handschriftencensus Rheinland-Pfalz hob die „sehr anerkennenswerte Arbeit" von Professor Blänsdorf hervor. Solche Fragment-Funde gebe es zwar häufig in Bibliotheken mit Inkunabeln, aber es mache sich kaum noch jemand die Arbeit, diese extrem schwierigen Schriften und vor allem die zahlreichen verwendeten Abkürzungen aufzulösen, betonte Winterer. Dank der Arbeit von Professor Blänsdorf sei ein richtiges Arbeitsbuch entstanden, mit dem Interessierte und Studenten gut arbeiten könnten.
Die Mainzer Martinus-Bibliothek präsentiert die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Seminar für Klassische Philologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Drei Studenten des Seminars für Klassische Philologie (Dominic Bärsch, Natalia Poleacova und Anna Regenauer) verantworten das Ausstellungskonzept.
Hinweise:
- Martinus-Bibliothek - Wissenschaftliche Diözesanbibliothek Mainz - Grebenstraße 8 (Eingang), Augustinerstraße 34 (Post), 55116 Mainz, Tel.: 06131/266-222, Fax: 06131/266-387, E-Mail: martinus.bibliothek@bistum-mainz.de, Internet: www.bistum-mainz.de/martinus-bibliothek - Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr
- „Die wiedergefundene Bibliothek. Antike und mittelalterliche Autoren in Pergamentfragmenten der Mainzer Martinus-Bibliothek". Herausgegeben und erläutert von Jürgen Blänsdorf. (Reihe: Aus der Martinus-Bibliothek, Heft 9. Hg. von Helmut Hinkel). Mainz 2012, 132 Seiten mit 20 Farbabbildungen, 12,50 Euro. ISBN 978-3-934450-54-7. Die Publikation ist in der Ausstellung sowie ansonsten nur in der Mainzer Dombuchhandlung Franz Stoffl (Markt 24-26) erhältlich.
tob (MBN)
Vorschau
Diakonenweihe im Mainzer Dom (21.4.)
Weihbischof Ulrich Neymeyr weiht zwei Priesteramtskandidaten
Mainz. Am Samstag, 21. April, empfangen zwei Priesteramtskandidaten um 9.30 Uhr im Mainzer Dom durch Handauflegung von Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr die Diakonenweihe. Geweiht werden Frank Lindenberger und Ludwig-Michael Siemes. Für 13.30 Uhr ist eine Dankandacht in der Seminarkirche in der Augustinerstraße vorgesehen. Die Diakonenweihe findet in der Regel ein Jahr vor der Priesterweihe statt. Danach arbeiten die Diakone ein Jahr lang in einer Pfarrgemeinde mit, bevor sie zu Priestern geweiht werden. Das Sakrament der Weihe ist in der Katholischen Kirche in drei Stufen gegliedert: die Diakonenweihe, die Priesterweihe und die Bischofsweihe.
am (MBN)
Benefizkonzert in St. Johannes Evangelist (22.4.)
Mehrere Chöre singen zugunsten des Vereins „Rettet den Regenwald"
Mainz. Der Mainzer Domchor (Leitung: Domkapellmeister Professor Mathias Breitschaft) und der Mädchenchor am Dom und St. Quintin (Leitung: Domkantor Karsten Storck) beteiligen sich an einem Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Rettet den Regenwald" am Sonntag, 22. April, um 17.00 Uhr in der Kirche St. Johannes Evangelist in Mainz, Dijonstraße 1. Erstmals wird bei diesem Konzert auch die Gesangsklasse des Gymnasiums Theresianum (Leitung: Ursula Kleffner) auftreten. Die Gesangsklasse ist im vergangenen Jahr in Kooperation mit den Chören am Mainzer Dom eingerichtet worden. Als vierter Chor tritt außerdem der Gospelchor „d'acCHORd" (Leitung: Bernhard Schulze) bei dem Konzert auf. Auf dem Programm steht weltliche und geistliche Chormusik aus allen Jahrhunderten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
am (MBN)
Arbeit.Alt.Arm
„Vorabend des 1. Mai" mit Kardinal Lehmann und Annelie Buntenbach (30.4.)
Mainz. Der traditionelle Empfang am „Vorabend des 1. Mai" mit dem Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, steht in diesem Jahr unter der Überschrift „Arbeit.Alt.Arm - Mit Rente in die Altersarmut". Auftakt ist am Montag, 30. April, um 18.00 Uhr mit einem Gottesdienst im Mainzer Dom, bei dem der Kardinal predigen wird. Beim anschließenden Empfang im Erbacher Hof wird Annelie Buntenbach, Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), zum Thema sprechen.
Dem Vortrag schließen sich Aussprache und Diskussion an. Für besonderes Engagement im Bereich der Ausbildung wird im Laufe des Abends der Preis der „Pfarrer Röper-Stiftung" durch Kardinal Lehmann verliehen. Veranstalter sind das Referat Berufs- und Arbeitswelt des Bischöflichen Ordinariates, die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und das Kolpingwerk.
Hinweis: Weitere Informationen über das Angebot des Referats Berufs- und Arbeitswelt im Internet unter www.arbeitswelt-bistum-mainz.de oder Tel.: 06131/253-864, Fax: 06131/253-866, E-Mail: betriebsseelsorge@bistum-mainz.de, Weihergartenstraße 22, 55116 Mainz.
am (MBN)
Antrittsvorlesungen an der Katholischen Fakultät (3.5.)
Professor Müller und Professor Huber stellen sich vor / Grußwort des Kardinals
Mainz. Am Donnerstag, 3. Mai, finden die Antrittsvorlesungen von Professor Dr. Philipp Müller und Professor Dr. Konrad Huber an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz statt. Beide sind seit 1. Oktober 2011 an der Fakultät tätig. Professor Müller ist Lehrstuhlinhaber im Fach Pastoraltheologie in der Nachfolge von Professor Dr. Michael Sievernich, und Professor Huber ist Lehrstuhlinhaber im Fach Neues Testament in der Nachfolge von Professor Dr. Marius Reiser.
Die Vorlesungen finden auf Einladung von Präsident und Senat der Johannes Gutenberg-Universität Mainz um 16.00 Uhr c.t. (Müller) und 17.00 Uhr c.t. (Huber) im Auditorium maximum (Alte Mensa), Johann Joachim Becher-Weg 5, statt. Müller spricht zum Thema „Dialogfähigkeit als Schlüsselqualifikation aller pastoralen Berufe"; Hubers Vorlesung steht unter der Überschrift „Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird danach!" (Offb 1,19). Nach der Begrüßung durch Dekan Professor Dr. Thomas Hieke wird der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, ein Grußwort sprechen.
Philipp Müller war nach seiner Priesterweihe im Erzbistum Freiburg (1991) ab 1992 wissenschaftlicher Angestellter am Fachbereich Pastoraltheologie der Universität Freiburg. Seine Promotion aus dem Jahr 1997 zum Thema „Dem Leben dienen. Das Seelsorgeverständnis von Linus Bopp im Kontext heutiger Seelsorgekonzeptionen" wurde mit dem Bernhard Welte-Preis der Universität Freiburg ausgezeichnet. Von 1999 bis 2006 war er Regens des Erzbischöflichen Priesterseminars der Erzdiözese Freiburg in St. Peter. Seine Habilitation (2006) trägt den Titel „Predigt ist Zeugnis. Grundlegung der Homiletik". Seit April 2008 war er Professor für Pastoraltheologie an der Katholischen Fachhochschule (KFH) Mainz.
Konrad Huber war seit 2007 Außerordentlicher Universitätsprofessor für Neutestamentliche Bibelwissenschaft am Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie der Universität Innsbruck. In den beiden vergangenen Semestern hatte er die Lehrstuhlvertretung der Professur für Neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz übernommen, wo er bereits seit 2006 als Universitätsdozent für Neutestamentliche Bibelwissenschaft tätig war. In Innsbruck war er zuvor als Assistenzprofessor (2001-2007) und als wissenschaftlicher Assistent (1993 bis 2001) tätig. Seine Dissertation aus dem Jahr 1995 trägt den Titel „Jesus in Auseinandersetzung. Exegetische Untersuchungen zu den sogenannten Jerusalemer Streitgesprächen des Markusevangeliums im Blick auf ihre christologischen Implikationen". Die Habilitationsschrift aus dem Jahr 2006 steht unter der Überschrift „Einer gleich einem Menschensohn. Die Christusvisionen in Offb 1,9-20 und Offb 14,14-20 und die Christologie der Johannesoffenbarung".
tob (MBN)
Publikationen
„Alles was atmet, lobe den Herrn!"
Buch zur Weihe der neuen Orgel in Mainz-St. Quintin erschienen
Mainz. Seit dem 18. März dieses Jahres verfügt die Kirche St. Quintin in Mainz wieder über eine Orgel. Anlässlich der Weihe der Orgel durch den Mainzer Generalvikar Prälat Dietmar Giebelmann ist jetzt ein Buch mit dem Titel „Alles, was atmet, lobe den Herrn!" erschienen. Die 64-seitige Publikation mit zahlreichen Farbbildern ist ab sofort zum Preis von fünf Euro im Dompfarramt (Domstraße 10) erhältlich. Die Orgel ist ein historisches Instrument von 1906, stammt aus der Werkstatt Nelson in Durham/Großbritannien und wurde von der Werkstatt Krawinkel restauriert.
Neben einem Beitrag über die Geschichte der Orgeln in Mainz-St. Quintin enthält die Broschüre unter anderem auch ein Porträt der neuen Orgel sowie einen Text zum Thema „Die Orgel als Werkzeug der Verkündigung". „Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Schauen in diesem Heft - und natürlich beim Hören unserer Orgel, im Gottesdienst oder bei einem Orgelkonzert", schreibt der Dompfarrer und Pfarrer von St. Quintin, Dr. Franz-Rudolf Weinert, in seinem Vorwort.
am (MBN)
MBN vor 40 Jahren
In 16 Orten des Bistums Mainz fanden vom 29. Januar bis 18. März 1972 „Informationstage für Pfarrgemeinderäte" statt. Daran nahmen nach Angaben der Bistumsnachrichten insgesamt 1.403 Pfarrgemeinderäte aus dem Bistum teil, „das sind etwa 40 Prozent der im Bistum Mainz Gewählten". Und weiter: „Die Informationstage sollten einen ersten Einblick in die Arbeit eines Pfarrgemeinderates gewährleisten." Im Jahr 1968 hatten erstmals Pfarrgemeinderatswahlen im Bistum Mainz stattgefunden.
Unter der Überschrift „Jugend fordert mehr Entwicklungshilfe" wird über einen offenen Brief der Diözesankonferenz der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) im Bistum Mainz an den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Erhard Eppler, berichtet. Darin fordert die KJG die Bundesregierung auf, „sich bei der Weltkonferenz für Handel und Entwicklung in Santiago de Chile für mehr Gerechtigkeit im Welthandel zu Gunsten der Dritten Welt einzusetzen. Sie solle außerdem mindestens ein Prozent des Bruttosozialproduktes für die Entwicklungshilfe bereitstellen."
Weiter heißt es über die Diözesankonferenz: „In einem Abschlusskommuniqué stellte die Diözesankonferenz selbstkritisch fest, dass sich junge und ältere Mitarbeiter in der Jugendarbeit für die Jugendlichen mehr verantwortlich fühlen sollten, um deren Resignation zu verhindern. Diese könnten sich bei allem Informations- und Diskussionsbedürfnis nur selten zu engagiertem Handeln durchringen. Das gelte auch für den religiösen Bereich. Die Konferenz beschloss daher, mehr Möglichkeiten der personalen Begegnung und des ehrlichen Austragens von Gegensätzen mit dem Willen, Einigendes und Gemeinsames zu finden, zu schaffen. Christlich geprägte Jugendarbeit müsse zu einer steten Provokation der Gesellschaft für echte Mitmenschlichkeit werden. Auch das weithin apolitische Verhalten vieler junger Katholiken wurde bedauert. Ihr Einfluss im jugendpolitischen Raum gehe offensichtlich zurück. Als Grund wurde mangelnde Experimentierfreudigkeit, gerade auch auf dem Gebiet der Koedukation, genannt, die die Arbeit oft uninteressant und unattraktiv mache."
Mainzer Bistumsnachrichten vom 26. April 1972 (Nr. 4/1972)