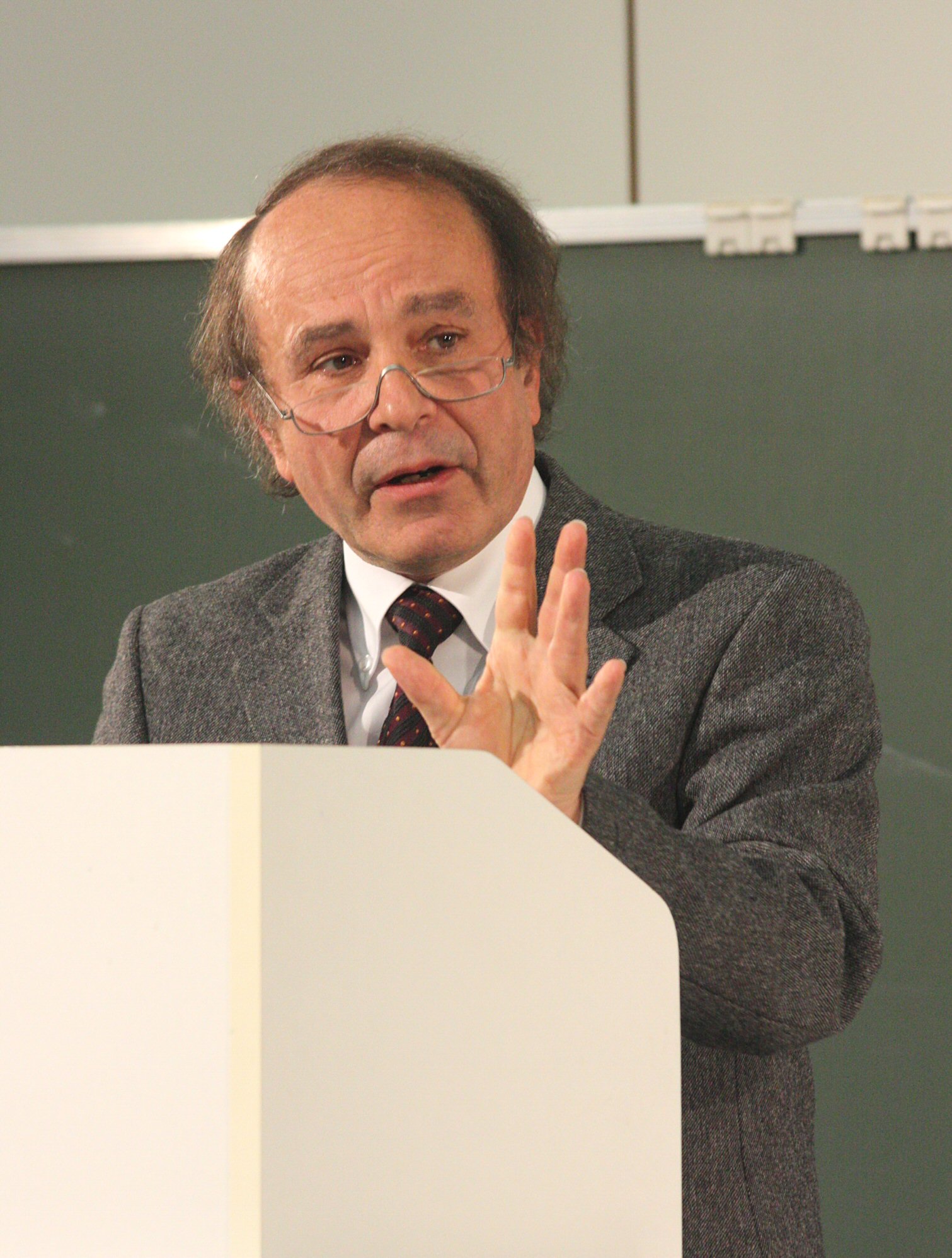Ein romantisierender Blick wird dem Buddhismus nicht gerecht
Gastvorlesung von Professor Michael von Brück bei der Mainzer Stiftungsprofessur
Oft hätten die östlichen Religionen „als Projektionsfläche für Kritik an der eigenen Kultur gedient, ohne sich mit den sozialen und politischen Realitäten der Religionen auseinander zu setzen“. Er wies darauf hin, dass der Buddhismus in der Geschichte „auch politisch korrumpiert worden ist“ und buddhistische Klöster Kriege geführt hätten. „Diese Geschichte, die im Westen gern verdrängt wird, gehört zur Geschichte des Buddhismus.“ Von Brück sprach im voll besetzten Hörsaal RW 1 im Neubau Recht und Wirtschaft, dem mit 1.200 Plätzen größten Hörsaal der Mainzer Universität.
Professor von Brück ist Leiter des Lehrstuhls für Religionswissenschaft an der Ludwig Maximilians-Universität in München. Seine Vorlesung stand unter der Überschrift „Buddhismus - Anspruch und Wirklichkeit“. Der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, hatte als Inhaber der diesjährigen Stiftungsprofessur die Vorlesungsreihe unter die Überschrift „Weltreligionen - Verstehen, Verständigung, Verantwortung“ gestellt.
Von Brück wies darauf hin, dass der Buddhismus „in seiner geschichtlichen Pluriformität kein Gebilde aus einem Guss ist“, sondern viele verschiedene Prägungen erfahren habe. Im Buddhismus gehe es „nicht einfach um einen nirwanischen Frieden auf Erden, sondern um die Befreiung des Menschen aus seinem Leid“. Buddha verstehe sich als Heiler für ein irrendes Bewusstsein des Menschen. Eine Veränderung werde dabei nicht durch das Folgen einer Autorität erreicht, sondern nur durch die Erkenntnis, die der Mensch aus eigener Erfahrung gewinne. Der Buddhismus verstehe sich als „ein Weg der Bewusstseinsschulung“. Und weiter: „Inbegriff dieses Weges ist das, was man Achtsamkeit nennen kann. Achtsamkeit ist das Kernstück der buddhistischen Daseinsanalyse überhaupt“ und sei „die Pforte des Menschen zu sich und der Welt“. Als Grundlage der buddhistischen Lehre stellte von Brück die „Vier Edlen Wahrheiten“ und den „Edlen Achtfachen Pfad“ vor. Er wies darauf hin, dass es oft schwierig sei, Begriffe der buddhistischen Religion adäquat in westliche Sprachen zu übersetzen.
Der Buddhismus betrachte nicht die Vergänglichkeit an sich als leidvoll, betonte von Brück. „Leidvoll ist der Versuch des Menschen, dem Augenblick Dauer zu verleihen, um sich so Stabilität zu geben.“ Der Mensch schaffe sich jedoch nur die Illusion von Beständigkeit und erfahre es als Frustration, keine Stabilität zu haben. Ursachen des Leids seien die „Ich-Haftigkeit, Gier und Hass“ des Menschen. „Nur durch Einsicht, die in meditativer Versenkung geschieht, kann die Wurzel des Leids überwunden werden“, sagte von Brück.
Kardinal Lehmann hatte in seiner Begrüßung zur dritten Vorlesung der Stiftungsprofessur das wissenschaftliche Wirken von Professor von Brück vorgestellt. Der evangelische Theologe habe sich immer wieder mit dem Verhältnis von Christentum und Buddhismus auseinandergesetzt. Lehmann zitierte aus von Brücks Buch „Wie können wir leben?“, das er als „Zeugnis eines lebendigen Dialogs zwischen den Religionen“ bezeichnete. Darin schreibt von Brück: „Vieles von dem, was ich schreibe, ist Nachdenken über das, was meinen Werdegang geprägt hat und sich in mir selbst abspielt: wie etwa ein Christ buddhistisch geprägt wird, ohne aufzuhören, Christ zu sein.“
Nächste Vorlesung mit Professor Johann Meier zum Judentum (19.5.)
Die nächste Gastvorlesung der Mainzer Stiftungsprofessur übernimmt am Dienstag, 19. Mai, Professor Dr. Dr. Dr. h.c. Johann Maier. Der emeritierte Professor für Judaistik an der Universität Köln wird zum Thema „Das Judentum. Eine Religion in Spannungsfeldern“ sprechen. Die Vorlesung mit anschließendem Kolloquium findet von 18.15 bis etwa 20.00 Uhr im Hörsaal RW 1 (Neubau Recht und Wirtschaft) auf dem Campus der Universität Mainz statt.