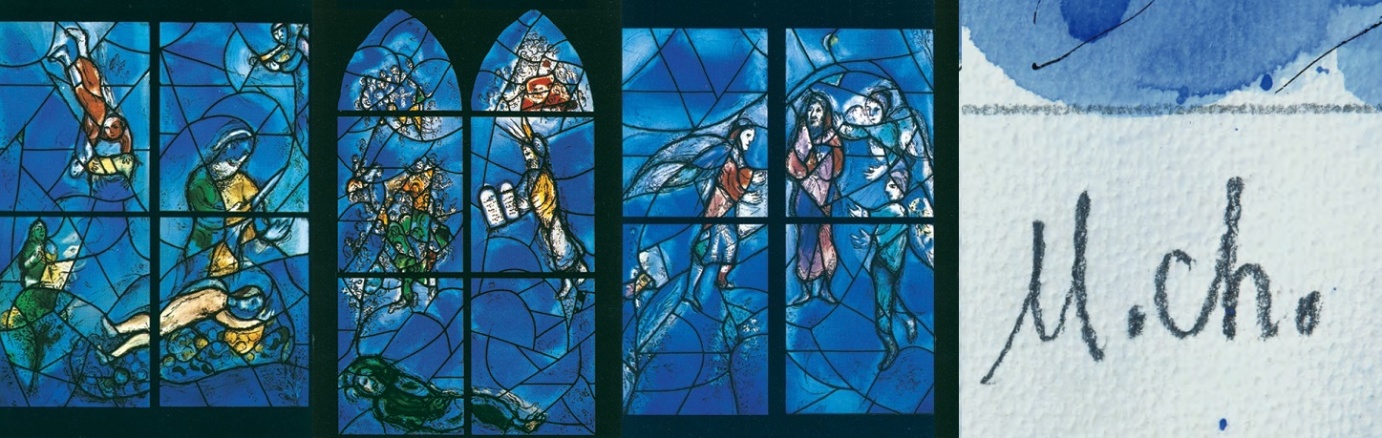22. Sonntag im Jahreskreis -
Pfr. Stefan Schäfer
Liebe Schwestern und Brüder,
etwas überzogen mag einem die Reaktion Jesu zunächst schon vorkommen:
einige seiner Jünger essen ihr Brot mit ungewaschenen Händen. Jesus scheint das nicht weiter zu stören, während die Pharisäer und Schriftgelehrten es nicht in Ordnung finden.
Was soll´s, möchte man denken.
Muss man über dieses Thema sich derart erregen, dass man die Kontrahenten gleich als Heuchler tituliert?
Oder sollte sich hinter dieser Auseinandersetzung doch mehr verbergen als eine Meinungsverschiedenheit über Tischsitten und religiöse Etikette?
Für Jesus geht es offensichtlich um Entscheidendes. Und das sucht er in der Konfrontation deutlich zu machen.
Zum Stand der Schriftgelehrten zählen zur Zeit Jesu jene, die es sich leisten können, ein theologisches Studium zu absolvieren und die dann als angesehene Experten in Sachen „Gott" und „Religion" den anderen gegenübertreten.
Diese anderen, die überwiegende Mehrheit, nennt man in den Kreisen der Schriftgelehrten aus Jerusalem „das Volk vom Land" und fügt gleich als stehende Redewendung hinzu: „welches das Gesetz nicht kennt".
„Das Volk vom Land, welches das Gesetz nicht kennt", d.h. aber: das ausgeschlossen ist von der Nähe Gottes.
Denn: was man nicht kennt, das kann man nicht befolgen. Das Gesetz Gottes aber muss man befolgen. Also kann, wer das Gesetz nicht kennt, nicht im Einklang sein mit Gott. Er steht Gott fern und ist ohne Gemeinschaft mit ihm.
Jesus aber steht entschieden auf der Seite derer, „die das Gesetz nicht kennen".
Und die, nebenbei, selbst wenn sie es kennen würden, es wahrscheinlich gar nicht halten könnten. All die Reinigungsvorschriften – wie sollten Leute sie einhalten, die erst einmal zum weit entfernten Brunnen laufen müssen. Sie brauchen das Wasser zum Trinken und Kochen und werden wenig Sinn haben für allerlei rituelle Waschungen.
Darum geht es in der heftigen Auseinandersetzung, von der das Evangelium heute erzählt. Das ist der Grund seines Ausbruchs:
Gerade diese Leute sind Jesus lieb. Die Schmuddelkinder, die mit den ungewaschenen Händen. Das „Volk vom Land, welches das Gesetz nicht kennt".
Für sie nimmt er Gott in Anspruch und wagt es zu vermuten, dass sie von der Gemeinschaft mit ihm keineswegs ausgeschlossen sind, sondern seiner Gnade möglicherweise sehr viel näher stehen als all die selbstgerechten Frommen aus Jerusalem:
Es kann doch wohl nicht sein, scheint Jesus sagen zu wollen, dass die Unterschiede des sozialen Standes und der Bildung auch noch im Bereich der Religion Bestand haben, ja hier sogar noch überhöht und zementiert werden!
Es kann doch nicht sein, dass die Differenzen von Besitz und Leistung, die das Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft bestimmen, auch vor Gott noch Gültigkeit haben sollen!
Wo, wenn nicht hier, müsste doch wohl ein Freiraum entstehen, in dem Menschen aufatmen können:
Weil sie nicht von außen beurteilt, eingeteilt und ausgegrenzt werden, weil sie nicht mehr darstellen müssen, als sie sind, weil sie sich einfach angenommen fühlen dürfen.
Wenn von Gott die Rede ist, scheint Jesus sagen zu wollen, sollten die Menschen ein Herz bekommen, das weit genug ist, nicht auf das Außen zu sehen.
Das es wagt, zu fragen, mit was für einem Menschen man es in Wahrheit zu tun hat.
Dieser ganze Streit um Rein und Unrein und um das Halten der Gebote ist keinesfalls nur eine Erscheinung einer uns fremden religiösen Welt, die mit uns nichts mehr zu tun hätte.
Wir dürfen uns durchaus fragen, wo denn bei uns die bleiben, die mit den Normen und Leistungsgeboten unserer Gesellschaft nicht so gut zurechtkommen. Die Ausgebrannten, die Überforderten, die, die mit ihrem Lebensentwurf irgendwie Schiffbruch erlitten haben: Finden sie denn wirklich einen Raum des Aufatmens und ein Ansehen in unserer Kirche, in unseren Gemeinden?
Wir könnten uns auch fragen, wie wir in einer Gemeinde z.B. auf die sogenannten „Fernstehenden" schauen, „welche das Gesetz nicht kennen" und die ihrer Sonntagspflicht schon länger nicht mehr nachgekommen sind.
Wenn sie sich dann doch sich wieder bemerkbar machen, etwa weil sie ihr Kind zur Taufe oder zur Erstkommunion anmelden wollen:
Heißen wir sie ehrlichen Herzens willkommen, interessiert an ihrem Lebensentwurf und an den Werten, die sie leiten und die sie doch immerhin wieder über die Schwelle des Pfarrbüros oder in einen Elternabend geführt haben?
Vielleicht auch daran, warum sie Abstand genommen und gehalten haben, an den Gründen, warum ihnen die Kirche phasenweise kein Angebot gewesen ist, Gründe, aus denen wir vielleicht etwas lernen könnten.
Oder stören sie uns ?
Meinen wir gar, sie erst einmal mit unseren Maßstäben konfrontieren zu müssen, an denen gemessen sie sich gefälligst als defizitär begreifen sollten?
Schon der Begriff des „Fernstehenden", den wir so selbstverständlich gebrauchen, ist ja verräterisch:
Können wir denn so sicher sein, dass wir, die wir andere so klassifizieren, wirklich die „in der Nähe" sind?
Näher am kirchlichen Leben- das mag ja sein!
Aber: deshalb auch näher bei Gott als die „Gottwohlgefälligen", als die seinem Willen Entsprechenden?
Das wäre schon sehr dicht an dem Missverständnis im Selbstbild, dem die Pharisäer und Schriftgelehrten im heutigen Evangelium erliegen.
Das Evangelium dieses Sonntags ruft uns zur Selbstkritik auf:
Vor allem dazu, uns einzugestehen, wieviel an Fassadenkosmetik wir immer wieder betreiben. Voreinander und auch vor uns selbst.
Und zuzugeben, dass doch auch wir nicht immer und in allem der Norm genügen und wie wenig es uns gelingt, „rein" und „gerecht" zu sein, vor uns selbst, vor anderen, vor Gott.
Und dazu schließlich, uns dann gesagt sein zu lassen, dass es darauf bei uns selbst wie bei den anderen vor Gott gar nicht ankommt:
Der sieht, nach Jesu entschiedener Meinung, einzig auf das Herz des Menschen.
Und er sieht auf das Herz, nicht um uns zu verurteilen, sondern mit dem Blick seiner Liebe.
Von dieser Zuversicht sollten wir erfüllt sein.
Sie sollte das Zusammenspiel derer prägen und bestimmen, die sich auf diesen Gott berufen.
Dann geht es nicht mehr darum, was einer darstellt und zu leisten vermag,
ob er „anständig" und den Normen entsprechend lebt,
oder es vielleicht grade so hinbekommt, den Schein und die Fassade zu wahren.
Dann bestimmen andere Fragen das Miteinander:
Was bist Du für ein Mensch?
Welche Gefühle bewegen Dich?
Was geht in Deinem Herzen vor?
Dann könnte ein Raum der Gnade entstehen, in dem Menschen aufatmen können, weil sie sich angenommen wissen, längst bevor sie sich selbst und durch eigene Leistung produziert haben.
Diesen Freiraum wollte Jesus uns schaffen.
Um Gott für die Schwachen und für die Sünder in Anspruch zu nehmen, ist er den Konflikt mit den Selbstgerechten eingegangen.
Um in uns allen ein letztes Vertrauen in Gottes Nähe und Zuwendung zu stiften, obwohl wir doch unrein und Sünder sind.
So heißt es im ersten Johannesbrief:
„Wenn unser Herz uns auch verurteilt – Gott ist größer als unser Herz!"
Amen