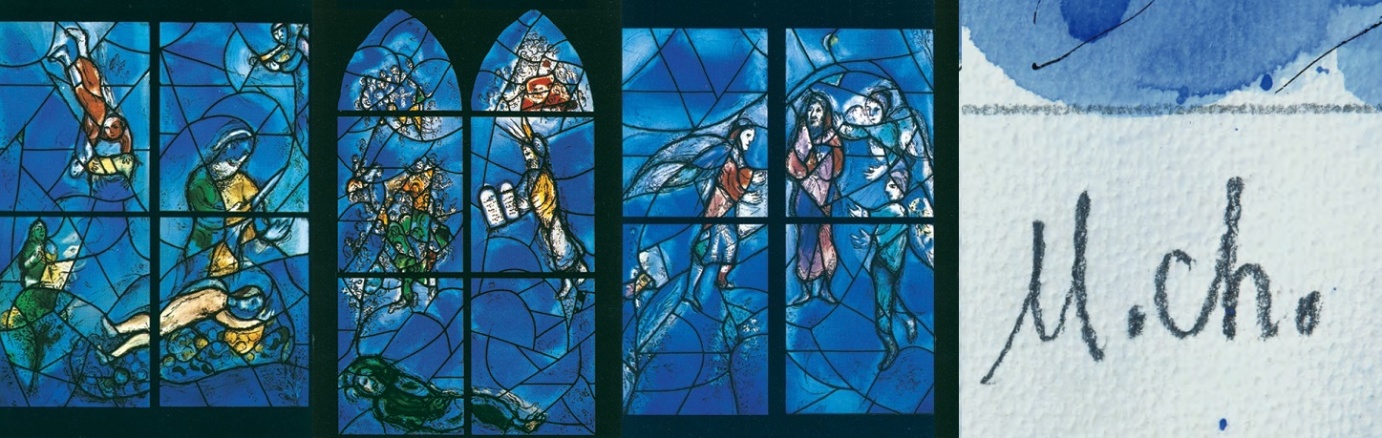"Mich wundert, dass ich fröhlich bin"
Wie in St. Stephan mit Predigt und Orgelfeuerwerk das Neue Jahr gefeiert wurde
Der Kontrast könnte nicht größer sein. Am Neujahrstag versetzt die Zeitung mit Berichten über die Silvesternacht den Leser in Angst und Schrecken: Brände, Aggressionen, Trunkenheitsdelikte, Unfallopfer und Attacken auf die Feuerwehr bestimmen die Schlagzeilen, auch wenn Millionen friedlich gefeiert haben.
Und dann hört der Messbesucher die oben zitierten Verse in der Predigt von Pfarrer Schäfer. Sie geben die unbestimmte Unsicherheit eines Nachdenklichen wieder, der sich Fragen stellt, auf die er keine Antwort weiß; Fragen nach der Dauer, der Richtung und dem Ende seines Lebens. Große Denker hat diese geistige Beschränktheit schon in Atheismus oder den Tod getrieben; der Dichter hier lässt sich aus unerklärlichen Gründen nicht klein kriegen von diesem Nebel vor seinen Augen; er baut auf einen guten Ausgang.
Die Verse wurden einem Magister Martinus von Biberach (gest. 1498) und auch Walter von der Vogelweide (gest. 1230) zu Unrecht zugeschrieben; sie sind in jedem Fall jahrhundertealt. Luther lehnte sie unsensibel als "Reim der Gottlosen" ab.
Ein glücklicher Sisyphos
Doch ihr Dichter erinnert in seiner Gelassenheit trotz aller Unwissenheit und Ungewissheit über Jahrhunderte hinweg an einen Denker des 20. Jahrhunderts, dessen im letzten Jahr aus Anlass seines 100. Geburtstags gedacht wurde: Albert Camus. Dieser fromme Atheist hat in seinen Romanen und dem philosophischen Werk die Absurdität eines agnostischen und sinnlosen Lebens ausgebreitet und gleichzeitig das Dasein und die grenzenlose Begrenztheit des Menschen akzeptiert, um unter moralischen Maßstäben ein humanes Leben zu führen und nicht den Selbstmord zu wählen. Camus veranschaulichte sein Gedankengebäude mit der griechischen Gestalt des Sisyphos, der zur Strafe unaufhörlich einen Felsblock einen Berg hinaufwälzen muss, um ihn dann jedes Mal wieder zu Tal rollen zu sehen. Aber, so Camus' Quintessenz: "Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen". Trotz aller Rätsel und Zweifel und zur eigenen Verwunderung kann man beim einen fröhlich, beim andern sogar glücklich sein.
"Zu sterben und hernach fröhlich"
Diese Mischung aus Nachdenklichkeit und Zuversicht spiegelte sich auch in der Musik der letzten halben Stunde des alten Jahres wieder, als Thomas Drescher ein musikalisches Feuerwerk an der Orgel abbrannte. Es brachte alte und neue Meister zu Gehör. Die erstaunlich zahlreichen Zuhörer ließen vermuten, dass vielen die Jahreswende mehr bedeutet, als nur lustig bei Sekt und Böllern aufs neue Jahr anzustoßen. Im Neujahrslied (um 1600), das der Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach zugrunde lag, war noch von einer anderen Fröhlichkeit die Rede:
"Das alte Jahr vergangen ist, / Wir danken dir, Herr Jesu Christ, / Dass du uns hast in aller G'fahr / So gnädiglich behüt't dies Jahr.
...
Hilf, christlich leben, seliglich / zu sterben und hernach fröhlich / am Jüngsten Tage aufzustehn, / mit dir in Himmel einzugehn."