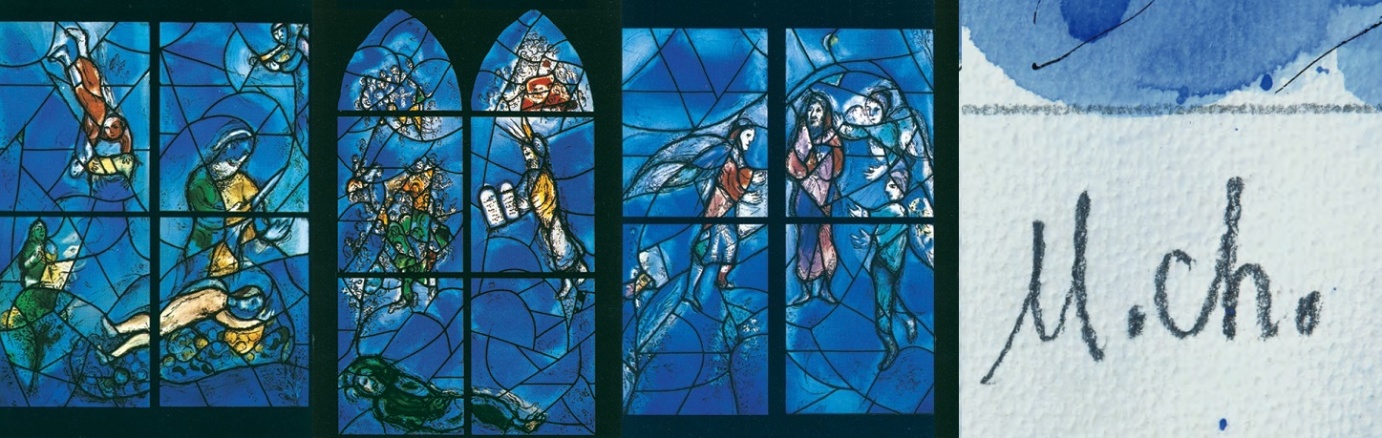Pfingsten - Pfr. Schäfer
Liebe Schwestern und Brüder,
die Pfingstlesung aus der Apostelgeschichte erinnert an die Geburtsstunde der Kirche.Sie erzählt vom Geheimnis ihres Anfangs, in dem schon alles angelegt und vorgezeichnet ist, was sie ist und sein soll: eine Kirche der Völker, eine alle umfassende, niemanden ausschließende Gemeinschaft.
Deshalb werden all die fremdartigen Völkernamen und Länder aufgezählt, die Parter, Meder und Elamiter und all die anderen, von Ost nach West, von Nord nach Süd, bis nach Rom, um deutlich zu machen:
Von ihrem geistgewirkten Ursprung her, ihrem inneren Wesen nach, ist die Kirche umfassend, universal. Menschen „aus allen Völkern unter dem Himmel" strömen zusammen und verstehen sich.
Das ist das Wunder des Pfingsttages, wie es uns heute erzählt wird.
Die lebendige Erinnerung an diesen Ursprung soll helfen, ihm heute treu zu bleiben: Es ist unsere Berufung als Gemeinde der Christen, als Kirche, ein Gleichnis der Gemeinschaft zu leben und ein Zeichen und Werkzeug der Einheit in aller Verschiedenheit für unsere Zeit und Lebenswelt zu sein.
Tief im Erbe der Menschheit ist ja etwas anderes angelegt:
Da nistet die Angst vor dem Fremden und Anderen. Aus ihr wächst immer wieder der Impuls, sich abzuschotten, das Eigene verteidigen zu wollen, als wäre es durch ihn bedroht, wachsen Misstrauen und Feindschaft.
Die alten Griechen nannten die Fremden „Barbaren".
Die Römer hatten ein und denselben Begriff, „hostes", für den Fremden wie für den Feind.
Für Christen können die Fremden weder Barbaren sein noch gar Feinde. Das Pfingstfest erinnert an eine revolutionäre neue Erfahrung:
Der Geist Gottes schert sich nicht um die Grenzen, die wir ziehen. Er spricht in allen Sprachen.
Er ist mir nahe, weil er meine Sprache spricht. Und er spricht ebenso den anderen in seiner Muttersprache an. Er ist ihm genauso nahe wie mir.
Von daher verbietet sich jede Abschottung dem Anderen und Fremden gegenüber. Pfingsten sprengt die Grenzen, die Angst und Arroganz errichten und weitet den Horizont. Wie bitter notwendig erscheint es heute, diese Einsicht des Glaubens in das öffentliche Gespräch zu bringen.
Wir sind, so hat es Papst Franziskus dieser Tage im Blick auf die aktuellen Herausforderungen formuliert, „aufgefordert, eine Kultur des Dialogs zu fördern, . . . die uns hilft, den anderen (. . .) den Fremden, Migranten, den Angehörigen einer anderen Kultur als geschätzten Gesprächspartner anzuerkennen."
In seiner Rede anlässlich der Verleihung des Karlspreises hat er den Politikern und Entscheidungsträgern eines manchmal müde und mutlos wirkenden Europa ins Gewissen geredet und ihnen eine pfingstliche Inspiration zu vermitteln versucht:
Es gelte, so der Papst, die „Größe der europäischen Seele" wiederzuentdecken, „die aus der Begegnung von Zivilisationen und Völkern entstanden ist, die viel weiter als die gegenwärtigen Grenzen der europäischen Union geht und berufen ist , zum Vorbild für neue Synthesen und des Dialogs zu werden." Er spricht vom „Gesicht Europas", das sich nicht dadurch unterscheidet, „dass es sich anderen widersetzt, sondern dass es die Züge verschiedener Kulturen eingeprägt trägt" und von seiner „Schönheit, die aus der Überwindung der Beziehungslosigkeit kommt."
Den selbsternannten Verteidigern des christlichen Abendlandes gegen eine vermeintliche Überfremdung hat er damit den Segen verweigert. Auf diesen Papst können sich Pegida, die AFD, Le Pen, Viktor Orban oder die neue polnische Regierung jedenfalls nicht berufen:
Abschottung und alle „Bestrebungen der Vereinheitlichung" seien „weit davon entfernt, Reichtum oder irgendwelche höheren Werte hervorzubringen". Im Gegenteil: Sie „verurteilen", so Papst Franziskus, „unsere Völker zu einer grausamen Armut (. . .). Statt Schönheit und Größe mit sich zu bringen, ruft das Ausgrenzen anderer Feigheit, Enge und Brutalität hervor. Weit davon entfernt, dem Geist Adel zu verleihen, bringt sie ihm Kleinlichkeit."
Wie dieses Ideal eines Zusammenlebens in Solidarität und Mitmenschlichkeit und Großzügigkeit - Papst Franziskus spricht von einem „Traum"- konkret umzusetzen und zu gestalten ist, - darüber darf und muss in Politik und Gesellschaft sicher gestritten werden.
Die Vision von einem Zusammenleben, in dem Mauern und Grenzen, die Angst und Misstrauen errichten, im Gespräch und in der Begegnung abgetragen werden, in diesen Auseinandersetzungen aber aufrecht zu erhalten und zu verteidigen, auch im Gespräch mit dem Nachbarn über den Gartenzaun, mit dem Kollegen am Arbeitsplatz oder am Stammtisch, dazu ermutigt uns die Erinnerung an den Ursprung der Kirche, an das Modell, das in ihr angelegt ist und der Geist, um den wir an Pfingsten bitten.
Zuerst aber und damit unser Zeugnis nach außen glaubwürdig und wirksam ist, muss die Gemeinde der Christen selbst immer mehr werden, was sie ist: ein Gleichnis solcher Gemeinschaft, ein Zeichen der Einheit in aller Verschiedenheit. Wir müssen deshalb wohl immer wieder auch darum beten, dass sich das Pfingstwunder in unserer Mitte tatsächlich ereignet.
Gott nimmt uns als Werkzeug in seinen Dienst, dem Traum vom Zusammenleben der Menschen jetzt schon, in der konkreten Gemeinde, Raum zu schaffen:
in aller Vorläufigkeit einen Ort zu gestalten, an dem der Andere nicht als Bedrohung wahrgenommen wird, sondern in seinem Anderssein als Chance und Herausforderung zum Dialog;
an dem der Wert eines Menschen sich nicht daran bemisst, wo er herkommt, was er kann und was er leistet, sondern seine Würde aufleuchtet im Blick der Liebe, die ihn als Ebenbild Gottes entdeckt;
wo man mit dem Fremden nicht fremdelt und, um noch einmal den Papst zu zitieren, „das Migrantsein kein Verbrechen ist" und man in die Gesichter schaut und nicht im rechnenden Denken nur auf die Zahlen.
Bitten wir dafür um den Beistand, den Heiligen Geist, für uns selbst und das Zeugnis, das wir im Lebensalltag zu geben haben, für unsere Gemeinde und unsere Kirche auf dem Weg zur Einheit und für die, die für das Zusammenleben der Völker Verantwortung tragen, in Europa und in der ganzen Menschheitsfamilie.
Amen