Veranstaltung: „Z(w)eitzeugenschaft und ihre Bedeutung für die Erinnerungsarbeit“
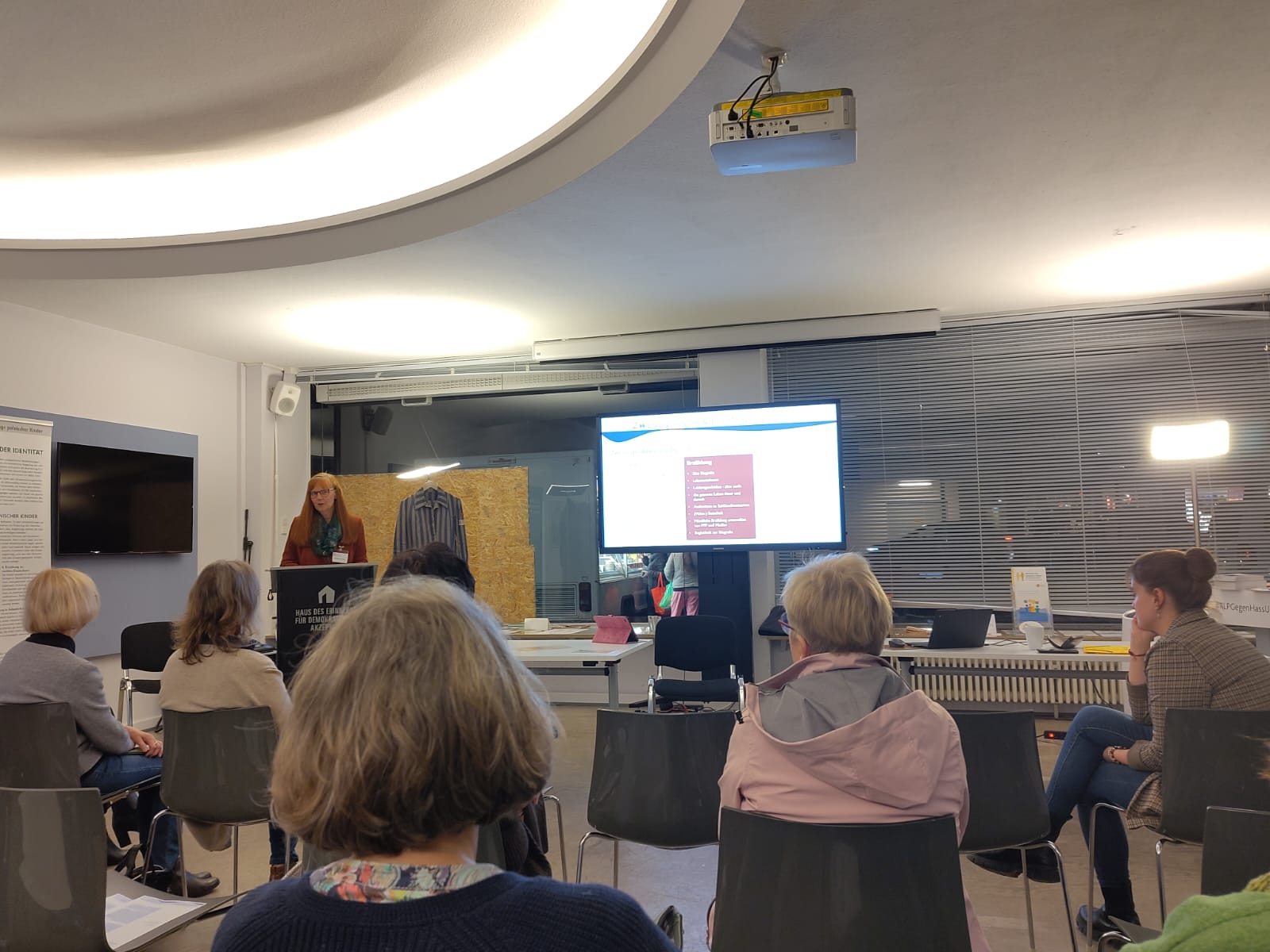
Die Veranstaltung, zu der 21 Lehrkräfte und Multiplikator*innen aus der Erinnerungsarbeit gekommen waren, stellte verschiedene Formate der Weitergabe der Lebensgeschichten von KZ- und Ghettoüberlebenden vor.
Begleitet wurde die Veranstaltung von Teilen der Ausstellung „Kinderraub im NS“.
Drei neue Formate der Erinnerung im Mittelpunkt
Dr. Christoph Krauß begrüßte die Teilnehmer*innen für die Geschäftsstelle Weltkirche/Gerechtigkeit und Frieden des Bistum Mainz. Franziska Hendrich stellte anschließend die Arbeit des Hauses des Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz vor.
Den Schwerpunkt des Nachmittags bildeten drei Blöcke, die unterschiedliche Formate der Weitergabe von Zeitzeugenerzählungen darstellen.
Dorota Nowakowska und Wiesława Melwińska – Töchter eines Auschwitz-Überlebenden
Eine der neuen Formen ist die Möglichkeit, dass Nachkommen der Überlebenden die Geschichte als Zeugen ihrer Eltern oder Großeltern weitererzählen. So tun dies auch Dorota Nowakowska und Wiesława Melwińska, die Töchter des Auschwitz-Überlebenden Jacek Zieliniewicz, die nun schon zum fünften Mal im Bistum Mainz zu Gast war. Sie erzählen die Geschichte ihres Vaters und setzen damit sein Engagement als Zeitzeuge fort.
Jacek Zieliniewicz, geb. 1926 in Polen, wurde am 20. August 1943 verhaftet und in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Am 20. August 1944 wurde er in das KZ Dautmergen bei Rottweil in Württemberg transportiert. Nach wenigen Monaten in diesem Außenlager des KZ Natzweiler wog er nur noch 38 kg. Im März 1945 wurden die Häftlinge während des Todesmarsches von französischen Truppen befreit. Jacek Zieliniewicz kehrte nach Polen zurück, arbeitete als Ingenieur und gründete eine Familie. Zum 60. Jahrestag seiner Verhaftung machte er mit seinen erwachsenen Töchtern einen mehrtägigen Ausflug nach Auschwitz und erzählte ihnen zum ersten Mal vom grausamen Schicksal seiner Jugend. Beide Töchter begleiteten ihren Vater seitdem oft zu Gedenkveranstaltungen und zu Schulgesprächen. Jacek Zieliniewicz verstarb im Mai 2018 im Alter von 92 Jahren. Seine Töchter möchten die Erinnerung an sein Schicksal weitergeben – für ihn Zeuginnen sein. Dorota Nowakowska trägt die Erinnerungen ihres Vaters auf Deutsch vor, ergänzt wird dies von einer Präsentation mit Bildern, Zitaten und Videos, die von der Moderatorin Stephanie Roth erläutert werden. In der anschließenden Fragerunde ist es dann vor allem Wiesława Melwińska, die den Schülerinnen und Schülern antwortet und über ihren Vater sowie die Auswirkungen seiner Haft auch auf ihr Leben berichtet.
Das Zweitzeugenprojekt des Bistum Mainz: „So haben sie es uns erzählt“
Im Jahr 2025 hat das Bistum Mainz das Zweitzeugenprojekt gestartet. Es hat zum Ziel, den Auftrag der Überlebenden der NS-Terrorherrschaft anzunehmen und ihre Lebenserfahrungen an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Dabei soll nicht nur an die leidvollen Erfahrungen der KZ- und Ghetto-Überlebenden erinnert werden, sondern die Geschichten bilden den Ausgangspunkt, um junge Menschen für die Mechanismen von Diskriminierung und totalitärer Herrschaft zu sensibilisieren und sie zu kritischem Denken anzuregen. Im Sinne der Zeitzeug*innen soll das Format der Menschlichkeit eine Stimme geben.
Im zweiten Block des Nachmittags stellten Sabrina Odelga und Stephanie Roth, die beide in diesem Projekt mitarbeiten die Geschichte von Józefa Posch-Kotyrba vor und demonstrierten beispielhaft, wie das Konzept der Zweitzeugenbegegnung an Schulen aussehen soll. Zum einen stehen die Person und ihre Erlebnisse, so wie sie diese selbst erzählt hat, im Mittelpunkt. Das persönliche Erzählen der Geschichten schafft einen nahbaren, niedrigschwelligen Zugang. Zum anderen ist die Erzählung eingebettet in ein didaktisches Konzept, das den Schülerinnen und Schülern Wissen über den historischen Hintergrund vermittelt. Hierbei ist vor allem die Situation der polnischen Zivilbevölkerung unter deutscher Besatzung von 1939 bis 1945 zu nennen. Im Anschluss an die Erzählung werden die Schüler*innen angeregt, sich intensiver mit der Biografie auseinanderzusetzen. Davon ausgehend werden sie angeregt zu überlegen, was die Geschichte des Überlebenden für uns heute bedeutet und welche Handlungsmöglichkeiten junge Menschen im Bereich der Erinnerungsarbeit, aber auch des aktiven Engagements für Demokratie und Menschenrechte haben.
Lesung von Reiner Engelmann aus „Alodia, Du bist jetzt Alice“, eine Zweitzeugenerzählung zu Alodia Witaszek-Napierała
Den dritten Block und Abschluss der Veranstaltung bildete die Lesung des Autors Reiner Engelmanns aus seinem Buch „Alodia, Du bist jetzt Alice“, in dem er das Schicksal der polnischen Überlebenden Alodia Witaszek-Napierała schildert. Sie wurde als Kind von den Nationalsozialisten geraubt, in ein Internierungslager verschleppt und in einem Lebensborn-Heim zwangsweise zur Germanisierung vorbereitet. Schließlich wurde sie an eine deutsche Familie vermittelt, die sie adoptierte. Ihre Mutter, die das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hatte, fand ihre beiden geraubten Töchter nach langer Suche wieder und diese kehrten nach Hause zurück. Es begann der lange Prozess der Wiedereingewöhnung in die polnische Familie.
Ermutigendes Fazit: Erinnerung hat Zukunft!
Zu allen drei vorgestellten Formaten fand ein reger Austausch unter den Teilnehmenden statt. Viele waren überrascht, wie gut die Vermittlung der Zeitzeugenerzählungen funktioniert. Die Geschichten berühren die Zuhörer*innen und geben der jeweiligen Person eine Stimme. Über die begleitenden Medien wird die Persönlichkeit der Überlebenden sehr gut erlebbar gemacht.
Die Veranstaltung schloss mit dem Fazit, dass die neuen Formate zu einer lebendigen Erinnerungskultur beitragen können und es sich lohnt, vielfältige neue Formen der Weitergabe auszuprobieren.