Fastnacht und Karneval, sie erfreuen sich besonders in katholischen Landstrichen großer Beliebtheit. Zwei der närrischen Hochburgen, Mainz und Köln, sind Domstädte. Was hat die fünfte Jahreszeit mit dem Glauben zu tun? Ein neues Buch gibt Auskunft.
Spiritualität der Narren

Fastnacht und Karneval, sie erfreuen sich besonders in katholischen Landstrichen großer Beliebtheit. Zwei der närrischen Hochburgen, Mainz und Köln, sind Domstädte. Was hat die fünfte Jahreszeit mit dem Glauben zu tun? Ein neues Buch gibt Auskunft.
Kostümierte strömen in den Mainzer Dom. Vierfarbbunte Uniformen so weit das Auge reicht. Am Fastnachtssonntag scheinen die Narren nicht nur auf den Straßen und in den Rathäusern, sondern auch in der Kirche das Regiment zu übernehmen.
In seinem Buch „Spiritualität der Narren“ widmet sich Autor Peter Krawietz auch dem Fastnachtsgottesdienst im Mainzer Dom. Die besondere Messe scheint es schon ewig zu geben. Dabei ist das Format erst wenige Jahrzehnte alt. Krawietz, ehemaliger Kultur- und Schuldezernent von Mainz, Fastnachtsexperte und Katholik, rollt die Geschichte auf: Er erzählt von zwei Kolpings-Brüdern und Mitgliedern der Fastnachtsgarden, die in den 1960er Jahren einen Priester um Erlaubnis fragten, mit Kostüm in den Sonntagsgottesdienst zu kommen. Grund war der Zeitdruck, sich zwischen Garde-Parade und heiliger Messe schnell umziehen zu müssen. Daraus entstand ein Brauch, der sich vor 30 Jahren weiterentwickelte:
Damals fiel der 50. Jahrestag des Gedenkens an den 27. Februar, den Tag der schwersten Bombardierung von Mainz im Zweiten Weltkrieg, auf den Rosenmontag. Wie bekam man Gedenken und Fastnacht unter einen Hut? Aus diesem Anliegen entstand ein Jahr später der sogenannte Gardegottesdienst.
Dass Fastnacht grundsätzlich etwas mit dem Christentum zu tun hat, ahnt jeder, der das Wort Fastnacht genauer betrachtet: Nacht vor dem Fasten. In seiner Publikation webt Peter Krawietz aktuelle Gebräuche ein in die große Tradition von Fastnacht, Karneval und Fasching. Die Wurzeln reichen bis in biblische Zeiten.
Ein Tor, der behauptet, Gott gebe es nicht
Im Alten und Neuen Testament findet sich die Figur des Narren. Krawietz zitiert etwa eine Passage aus dem Lukas-Evangelium über den reichen Mann, der seine Schätze hortet. „Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast?“. Ein Tor ist auch der, der behauptet, Gott gebe es nicht, so Psalm 53. Und: Der Mensch soll kein Narr sein und umkehren, fordert der Apostel Paulus. Krawietz fasst dies so zusammen: „Die Fastnachtszeit gibt eine kurze Zeit lang Gelegenheit, um Klarheit zu gewinnen, den Narren, den ,alten Menschen‘ zu spielen; dann folgt die Fastenzeit, die Gelegenheit gibt, mit der gemachten Erfahrung den ,neuen Menschen‘ anzuziehen.“ Nicht wenige Narhallesen lebten in diesem Geist.
Die Mischung aus Narretei, Frohsinn und Erinnerung an die Vergänglichkeit vermitteln viele Fastnachts- und Karnevalslieder, die in Mainz und Köln gepflegt werden. Einige sind in der Vor- oder Nachkriegszeit entstanden, etwa „Määnz bleibt Määnz“ (1951) von Martin Binger oder „Heimweh nach Köln“ (1936), bekannt unter „Ich mööch zo Fooß noh Kölle jon“, von Willi Ostermann. Und auch das, so Krawietz, haben Mainz und Köln gemeinsam: „Beide Städte wurden in den letzten Kriegsmonaten durch Bomben so zerstört, dass man sie kaum wiedererkannt hätte, hätten nicht beide Dome wie Riesen, denen niemand etwas anhaben kann, aus den Trümmern herausgeragt.“
Krawietz bündelt verschiedene Aspekte fastnachtlicher Hintergründigkeit. So auch der Hinweis auf die Gegenwelt des mittelalterlichen Karnevals. „Für kurze Zeit trat das Leben aus seiner üblichen, gesetzlich festgelegten und geheiligten Bahn und betrat den Bereich der utopischen Freiheit“, erklärt er. Das Lachen der Menschen errang nicht nur einen kleinen Sieg über die hierarchischen Schranken, sondern auch über die Schrecken des Todes. Zugleich war der Karneval ein „Moment des Sieges über jede Gewalt, über die irdischen Herrscher“.
In der Geschichte habe sich die Interpretation des Narren immer wieder gewandelt. Der rote Faden aber sei: „Der Mensch ist fehlbar“, so Krawietz, „aber auch mit Geist und Seele ausgestattet“, er gibt seine Schwachheit zu, „aber verzweifelt nicht an ihr, sondern nimmt die Dinge mit Humor“.
Zur Sache
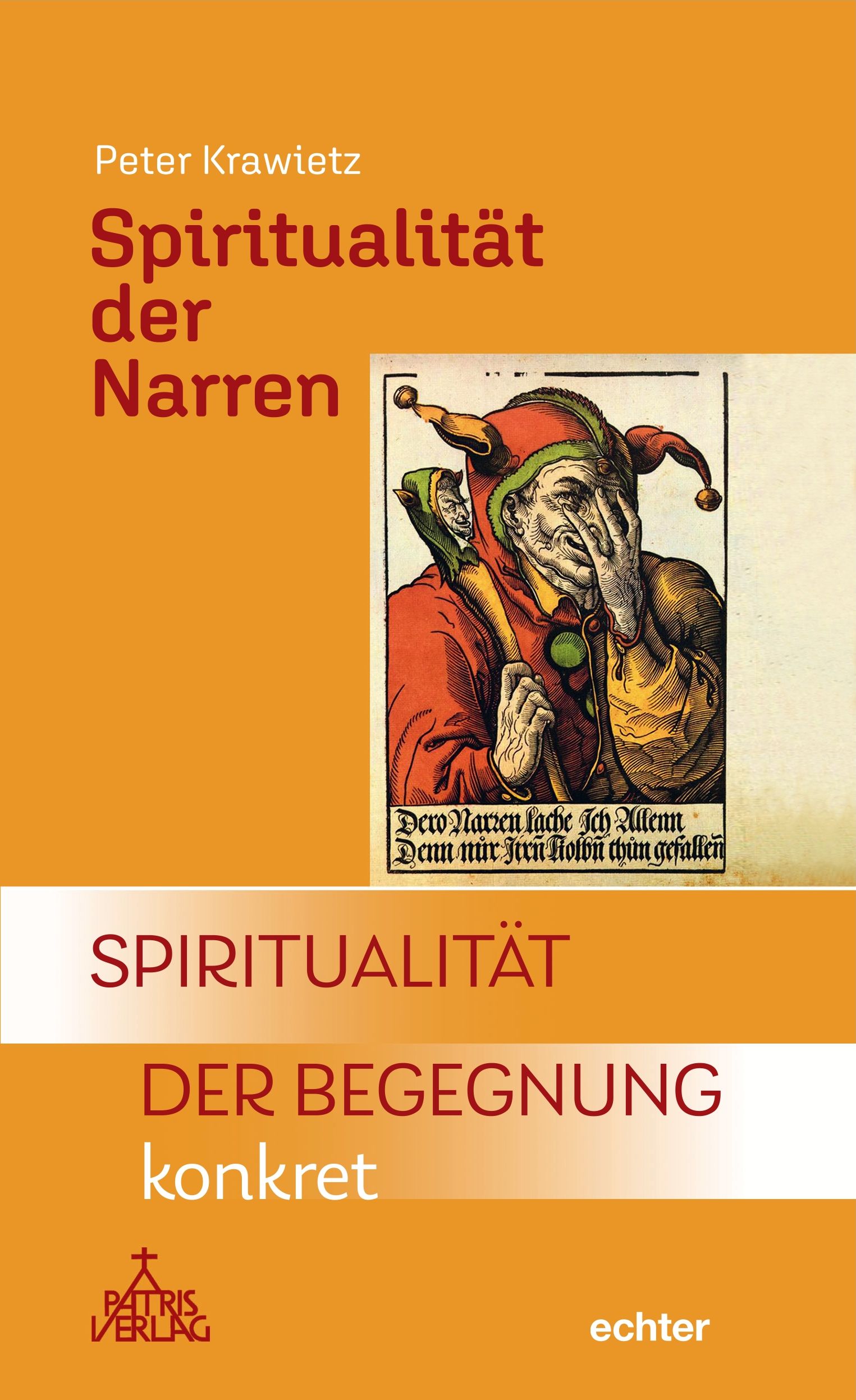
Peter Krawietz: „Spiritualität der Narren“, circa 100 Seiten, Echter-Verlag, 12,90 Euro. Das Buch gehört zur Reihe „Spiritualität der Begegnung – konkret“, mit herausgegeben von Bernhard Brantzen, Ständiger Diakon, und Hubertus Brantzen, Pastoraltheologe, beide aus Mainz. Entstanden ist die Buchreihe vor dem Hintergrund diakonischer Erfahrungen.
Missionarisch gegen „Mucker und Philister“

Was hat Sie motiviert, ein Buch über Fastnacht und Spiritualität zu schreiben?
Bereits 2016 hatte ich ein Buch über die Fastnacht am Rhein geschrieben, habe viele Vorträge über ihre Wurzeln gehalten. Ende 2023 kam einer der Herausgeber der Buchreihe „Spiritualität der Begegnung – konkret“ auf mich zu. Er fragte mich, ob ich eine Folge beitragen wolle. Beim vorgeschlagenen Thema „Fastnacht und Spiritualität“ hat es bei mir sofort gefunkt.
Diejenigen, die die Fastnacht ablehnen, sehen oft nur eins: Fressen, saufen, Tabus brechen. Und das soll auch noch Kultur sein? Dann sage ich: Schaut mal genauer hin, beschäftigt euch nur mal mit den Namen Fastnacht, Karneval, Fasching. Ich habe das Gefühl, man müsse fast missionarisch den „Muckern und Philistern“, also allen Nörglern und Stimmungskillern, sagen: Achtung, Fastnacht geht tiefer, als ihr denkt und beobachtet.
Kann man heutzutage angesichts einer steigenden Zahl von Krisen und Kriegen überhaupt noch unbeschwert Fastnacht feiern?
Natürlich. Es gibt aus der Geschichte gute Beispiele, trotzdem Fastnacht zu feiern. Nach dem Zweiten Weltkrieg sagten die Generäle in der französischen Besatzungszone in Mainz: Bitte macht Fastnacht! Das war 1946, als es noch Vermisste und Trümmerlandschaften gab. Dadurch konnten die Leute wenigstens stundenweise über dieses Elend hinausschauen. Auch das hat für mich etwas mit Christentum zu tun: Dass es über Not und Elend hinaus Dinge gibt, über die man sich freuen kann.
Außerdem hat die Fastnacht in Mainz auch noch das Element der Gesellschaftskritik. Darum finde ich es gerade jetzt angebracht, den Mund aufzumachen. Die Kritik in der Fastnacht soll aber nicht draufhauen. Sie arbeitet mit Ironie, Sprachgefühl und Bildhaftigkeit, mit literarischen Mitteln eben. So macht sie nicht nur demjenigen Freude, der sie übt, sondern auch dem, der zuhört.
Wie kann die närrische Spiritualität gepflegt werden?
Indem man sich bewusstmacht, dass ich mir und anderen Freude bereite. Das ist eine christliche Einstellung. Auch die Nachdenklichkeit gehört dazu sowie auf die närrischen Insignien zu achten, wie etwa den Spiegel. Schau in den Spiegel. Findest du dich da? Oder müsstest du länger verweilen beim Betrachten? Der Beichtspiegel heißt ja nicht umsonst so. Beim fröhlichen Fastnacht-Feiern ist man nicht belastet durch die Dinge des Alltags. Man macht sich locker und kommt zu einer gewissen Freiheit. Gemeint ist aber nicht die Freiheit, einfach zu machen, was man will. Ich meine damit, frei von Beschwernissen zu sein. So kommt der Mensch zu sich selbst.