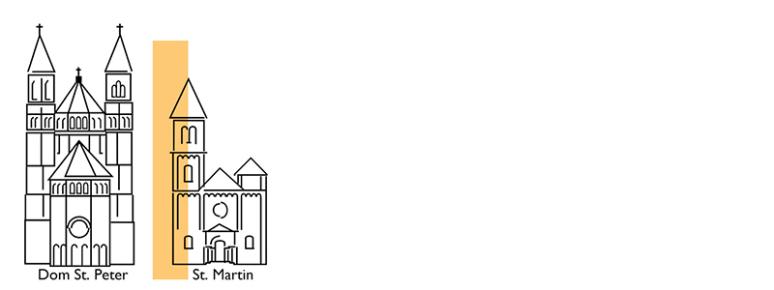Festakt zum Gedenken an 900 Jahre Wormser Konkordat

25. September 2022
PROGRAMM
Georg Christoph Wagenseil (1715-1777): Sonate D-Dur; WV 513, 1.Satz Allegro
Grußwort Bischof Dr. Peter Kohlgraf, Mainz
Grußwort Oberbürgermeister Adolf Kessel, Worms
Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Worms
Harald Genzmer (1909-2007): 1. Sonate für Flöte & Klavier, 2.Satz Ruhig fließend
Hinführung zum Festvortrag Propst Tobias Schäfer
Festvortrag: (Beginn 28:45) Prof. Dr. Paul Kirchhof, Heidelberg Die Entwicklung von „weltlicher und geistlicher Gewalt“ in der Gegenwart
Dank und Einladung zum Umtrunk: (Heinz Thesen, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates)
Carl Ph. E. Bach (1714-1788): Hamburger Sonate in G-Dur; Allegretto & Rondo – Presto
Musikalische Gestaltung: Lisa Lainsbury, Flöte & Joachim Schmitz, Klavier
Youtube
Paul Kirchhof
Die Entwicklung von „weltlicher und geistlicher Gewalt“ in der Gegenwart
Worms, 25. September 2022
- 900 Jahre Wormser Konkordat -
1. Die Bedeutung des Wormser Konkordats für das gegenwärtige Verhältnis von Staat und Kirche
Wenn wir heute an das Wormser Konkordat vor 900 Jahren erinnern, sehen wir Kaiser Heinrich und Papst Calixt in einem Versöhnungsprozess, der den Kampf um Vorrang und Gehorsam beenden, die Verflechtung von Kirche und Politik in einer Verfahrensordnung entwirren sollte. Dieser Vertrag schuf Frieden, betonte die von Herzen kommende Eintracht – concordia – der Vertragspartner. Wir nennen diesen Friedensvertrag deshalb „Konkordat“.
Vordergründig stritten Papst und Kaiser in diesem Investiturstreit um die Frage, wer die Bischöfe einkleiden dürfe (vestimentum, Weste). Mit der Übergabe der geistlichen Symbole von Ring und Stab – der Ring als Zeichen der Vermählung des Bischofs mit seiner Bischofskirche, der Stab als Zeichen der geistigen Leitungsgewalt – wurden dem Bischof die Gnadengaben für sein Amt in seiner Diözese zugesprochen. Die salischen Herrscher Heinrich IV. und Heinrich V. haben über Jahrzehnte die Bischöfe und Äbte ihres Reiches durch Übergabe von Ring und Stab eingesetzt, ihnen dabei auch zunehmend weltliche Herrschaft übergeben, sich dafür aber Gefolgschaftsdienste, Treue versprechen lassen. Nun beanspruchte der Papst, die Zeichen Ring und Stab an die Bischöfe zu übergeben. Nach der damaligen in Mythen und Ritualen denkenden und handelnden Zeit forderte der Papst dadurch die in Ring und Stab vergegenständlichte Macht über die lateinische Christenheit.
In diesem Grundsatzstreit fand das Wormser Konkordat einen Kompromiss: Der Bischof wurde doppelt in sein Amt als geistliches und als weltliches Fürstentum eingesetzt. Der Kaiser überlässt Gott und der katholischen Kirche jegliche Investitur mit Ring und Stab, der Papst überlässt dem Kaiser die Übergabe des Zepters und damit einer weltlichen Gewalt an den Bischof. Er gewährleistet überdies eine prägende Mitwirkung des Königs an der Bischofswahl dadurch, dass er bei der Wahl durch das Domkapitel persönlich anwesend sein und bei strittigen Wahlen außerdem die Zusammensetzung des Wahlgremiums beeinflussen durfte.
Dieses Wormser Konkordat schafft Frieden durch Trennung der geistlichen und der weltlichen Gewalt, löst die Streitfrage der Bischofseinsetzung durch ein ausgleichendes, konsenssuchendes Verfahren. Das Konkordat ist ein vereinbarter Dissens, in dem keine der Vertragsparteien der Sieger ist, keiner sein Gesicht verliert, jeder dem Weg verfahrensgeordneter pragmatischer Problemlösung zustimmt. Die harten Fragen nach der rechtmäßigen Herrschaft, nach der Vertretung Gottes auf Erden, nach dem um dieser Herrschaft willen geführten gerechten oder ungerechten Krieg bleiben offen. Ein wesentlicher Kern des Konkordats ist sein Schweigen.
2. Lehren des Konkordats für die Gegenwart
a. Unterschiedliche Ausgangslage
Vergleichen wir die Ausgangslage von Wormser Konkordat 1122 – Krieg, Bann und auch der Demütigung – mit der heutigen Wirklichkeit, so wird eine Wormser Lehre für heute bewusst: Obwohl damals der Streit um weltliche und geistige Macht von zwei Amtsträgern geführt wurde, die ihre Herrschaft jeweils unmittelbar von Gott ableiteten, schafften beide Krieg statt Frieden, Hass statt Nächstenliebe. Heute leben wir in einer Welt, die menschliche Streitlust zu einer Grundlage ihrer Rechtsgemeinschaft macht und dort einhegt. Der Parlamentarismus ist auf den Gegensatz von Regierung und Opposition angelegt. Die Wirtschaft kämpft im Wettbewerb. Die Medien erzeugen täglich Aufgeregtheit und Empörung. Das Recht wahrt in diesem System den inneren Frieden und sucht Krieg zu verhindern. Unser Ideal ist die Konfliktlösung allein durch sprachliche Auseinandersetzung – letztlich durch die Recht-Sprechung. Für dieses Konzept brauchen wir immer wieder kirchliche Worte zur „concordantia“.
Der politische Ausgangsbefund damals und heute ist allerdings grundverschieden: Heute breitet sich eine Gleichgültigkeit gegenüber Fragen des Glaubens aus. Die Kirchen verlieren mit der christlichen Botschaft Einfluss auf viele Menschen und zeigen der Öffentlichkeit täglich ihre innere Krise und einen Streit der Bischöfe. Der Staat behandelt zumindest durch einige Repräsentanten Glauben und Kirche als fast belanglos. Doch auch der säkulare Staat braucht ein Menschenbild mit einer Verantwortlichkeit, die im Diesseits nicht entgolten wird, in der Gerechtigkeit Gottes einen Ausgleich findet. Eine Gerechtigkeit für einen hilflosen Kranken, einen ausgegrenzten Fremden, ein noch sprachloses Kind, eine Weltregion der Armen entfaltet sich nur in einer inneren – moralischen – Bindung.
Heute kämpfen wir nicht um eine Herrschaft durch Religion, sondern suchen eine Herrschaft ohne Religion vor geistiger Leere zu bewahren. Staat und Kirche sind für denselben Menschen da, der auf Frieden, Existenzsicherheit und Freiheit hofft, der zugleich nach dem Sinn seines Lebens, nach der Zukunft jenseits des Todes fragt. Diese Zukunft ist nicht deshalb ein bloßes Nichts, weil der Mensch in empirischer Erfahrung und freiheitlicher Vernunft diese Zukunft nicht voraussehen kann. Der Mensch fragt nach der Zukunft, die er erahnen, empfinden, erhoffen, denken, glauben kann. Diese Fragen richtet er an Staat und Kirchen.
b. Nachbarschaft von Staat und Kirche in Autonomie
Der moderne Verfassungsstaat hat das Verhältnis von Staat und Kirche gut geregelt. Das Grundgesetz trennt Staat und Kirche und ordnet sie in guter Nachbarschaft einander zu, lässt die religiöse Wahrheitsfrage offen, damit Menschen aller Religionen innerhalb des Staates in Frieden miteinander leben können, anerkennt die Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie die Kirchenfreiheit als wesentliche Elemente einer freiheitlichen Demokratie. Zugleich erwartet der Staat von den Kirchen einen intellektuell-ethischen Beitrag zum inneren und äußeren Frieden der Menschen, sieht in der kirchlichen Lehre von der Würde und Freiheit (Gotteskindschaft) jedes Menschen ein Fundament moderner Verfassungsstaatlichkeit und Menschenrechte. Das Grundgesetz formuliert deshalb in seiner Präambel eine „Verantwortung vor Gott und den Menschen“, die dem deutschen Volk als Verfassunggeber bewusst ist.
Dieses Verfassungskonzept mag durchaus auch als eine Spätfolge des Wormser Konkordats verstanden werden. Dieser Friedensvertrag vermittelt uns jedenfalls vier grundsätzliche Leitgedanken:
(1.) Die in Worms angelegte Entsakralisierung von staatlicher Herrschaft ist heute vollzogen. Zwar haben sich noch bis zum Ende des I. Weltkriegs Herrscher als Herrschende „von Gottes Gnaden“ verstanden. In Verfassungsstaaten bedarf aber jede Herrschaft einer rationalen, verfahrensrechtlichen Legitimation, muss sich als demokratische Herrschaft auf Zeit immer wieder in seinen Herrschaftsentscheidungen rechtfertigen.
(2.) Auch eine Entweltlichung geistlicher Herrschaft ist weitgehend gelungen. Die Kirchen widmen sich ihrem Auftrag, dieser Welt den Glauben an Gott zu verkünden, die individuelle Begegnung mit Gott zu vermitteln, Nächstenhilfe zu üben, den weltweiten Frieden zu sichern, mit der Kraft des Wortes, der Glaubensgemeinschaft, des Vorbildes.
(3.) Die im Wormser Konkordat angelegte Trennung von weltlicher und geistlicher Gewalt, von Königsherrschaft und Priestertum scheint das Religiöse als Alleinaufgabe der Kirchen zu verstehen, dementsprechend aus dem Bereich der Staatlichkeit zu verdrängen. Derzeit propagiert die Weltanschauung eines kämpferischen Laizismus einen Staat ohne Gott, sucht Religion und Kirchlichkeit gänzlich aus dem öffentlichen Leben – aus Staat und Wirtschaft – zu vertreiben. Ein solcher Kampf widerspräche der weltanschaulichen Neutralität des Staates, der die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen friedlich nebeneinander leben lässt, dabei gewährleistet, dass eine Weltanschauung nicht eine andere im Kampf gegen Andersglaubende und Andersdenkende zu verdrängen sucht.
(4.) Bei der Frage des Vorrangs einer Macht und eines Rechts gegenüber dem anderen ist es klug, die Machtfrage nicht durch Unterwerfung des anderen zu entscheiden, sondern in der Schwebe zu lassen. Die heutige Schwebelage besteht darin, dass der Staat das äußere Verhalten des Menschen verbindlich regelt, das innere Verhalten des Menschen – sein Denken, Hoffen, Glauben – dem geistigen Einfluss von Freiheitsberechtigten, insbesondere den Kirchen, öffnet. Vor 200 Jahren hat Joseph von Eichendorff den Freiheitskämpfern zugerufen: „Keine Verfassung garantiert sich selbst.“ Jeder, der die Freiheit erkämpft, muss sie nun mit Leben füllen. Böckenfördes für die Religionsfreiheit formulierte Wort, der Staat lebe von Voraussetzungen, die er selbst nicht erzwingen könne, ist ebenfalls zutreffend, muss aber im modernen Staat ergänzt werden durch den Satz, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst pflegt und fördert. Andernfalls würde er seine legitimen Wurzeln verkümmern lassen.
3. Die Erneuerung des Staates
Der deutsche Staat beginnt seine Verfassungsstaatlichkeit mit der Negation des gottlosen Staates des NS-Regimes. Die Bayrische Verfassung, 1946 formuliert, spricht von einem „Trümmerfeld, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Wert, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen geführt hat“. Das Grundgesetz konzipiert den Gegenentwurf zum Nationalsozialismus, der ohne Gott war und die Kirchen verfolgt hat. Die Präambel spricht vom deutschen Volk, das sich „im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“ diese Verfassung gegeben habe, weist in der doppelten Verantwortlichkeit auf die Begrenztheit staatlicher Gewalt, die ihre Verantwortlichkeit vor Gott in der Verantwortlichkeit vor dem Menschen als Gotteskind wahrnehmen und sichtbar machen muss.
Das Grundgesetz unterbreitet das Angebot der Religionsfreiheit und erwartet – wie bei allen Freiheitsrechten –, dass der Grundrechtsberechtigte dieses Angebot annimmt. Die Berufsfreiheit verfehlte ihr Ziel, wenn alle Menschen sich am Erwerbsleben nicht beteiligten und nur noch auf staatliche Sozialleistungen warteten. Das Angebot der Familienfreiheit nähme der Demokratie im Staatsvolk, dem Rechtsstaat in seinen Bürgern ihre Zukunft, wenn die Mehrzahl der Menschen kinderlos bliebe. Die Wissenschaftsfreiheit darf nicht zur Folge haben, dass sich niemand mehr um wissenschaftliche Forschung und Lehre kümmert. Würden die Freiheitsrechte immer nur negativ wahrgenommen, verhielten sich alle Menschen dabei rechtens. Doch der freiheitliche Staat ginge an seiner eigenen Freiheitlichkeit zugrunde.
In ähnlicher Weise erwartet der religiös neutrale Staat, dass der Bürger sich mit Gott auseinandersetzt, religionsmündig wird, die Botschaften von Religion und Kirche verantwortlich in ihrer Bedeutung für ihn als Individuum wie für die Rechtsgemeinschaft erwägt. Das Grundgesetz sorgt ausdrücklich dafür, dass die Menschen in einem Religionsunterricht als ordentlichem Lehrfach religionsmündig werden, also in den Raum des Religiösen eintreten und dort Erfahrungen und Kenntnisse sammeln, um dann zu entscheiden, ob das Religiöse für ihr Leben Bedeutung gewinnen soll. Wie ein Kind, das kein Musikinstrument gelernt hat, keine reale Freiheit zum Musizieren gewinnt, ein Kind, das nicht lesen gelernt hat, von Literatur, Wahl und Vertragsschluss ausgeschlossen ist, so wird ein Kind, das Religion nicht erlebt und kirchliche Botschaften nicht empfangen hat, die Realität der Religionsfreiheit nicht erfahren.
Die Verfassung schützt zudem die Sonn- und Feiertage als „Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“, gibt den Kirchen auf ihren Antrag den Körperschaftsstatus, schafft damit die Voraussetzungen und den Rahmen, in dem die Religionsgemeinschaften „das Ihre“ zu den Grundlagen von Staat und Gesellschaft beitragen können (BVerfG).
Verfassungsrechtlich ist der deutsche Verfassungsstaat somit zur Pflege der religiösen Wurzeln seiner Verfassung veranlasst. Er ist verpflichtet, die Rahmenbedingungen einer Qualifikation zur Religionsfreiheit, zur Wahrnehmung dieser Freiheit und zur Organisation von Kirchlichkeit bereitzustellen. Viele Einzelvorschriften drängen die Kirchen zur Entfaltung caritativer Nächstenliebe, zu einer sichtbaren Kirchlichkeit in Universitäten, in der Bundeswehr, in staatlichen Einrichtungen, insbesondere in Schulen.
Dabei ist entscheidend, dass die Lehrer gläubig sind und ihren Glauben beherzt vermitteln. Bei einem Gespräch mit Schülern der Oberstufe eines Gymnasiums über Beginn und Endes des Lebens fragte mich einmal eine Schülerin, wann die Seele geboren werde. Diese Kernfrage war von der Lehrerin zu einem intensiv bedachten Thema gemacht worden. Ich habe zunächst erläutert, dass naturwissenschaftlich-empirische Beweisbarkeit und intellektuell-logische Begründung die Frage nicht beantworten können. Wenn wir aber von einem Schöpfergott sprechen, können wir den Beginn der menschlichen Seele sinnvoll verstehen. Auch der Staat braucht die geistige Weite des Religiösen.
4. Die Erneuerung der Kirchen
Die Kirchen haben den Auftrag, den Glauben an Gott zu verkünden, die Nächstenliebe und die Friedensbotschaft zu verbreiten. Doch scheinen sie gegenwärtig nicht in der Lage, diese Freiheitsangebote kraftvoll und beherzt anzunehmen. Das hat vor allem zwei Gründe: (1.) Die Missbrauchsverbrechen haben Kirche und Gläubige tief erschüttert. (2.) Das Kirchenrecht droht in seinen Anforderungen an die Lebensform des Priesters Kirche und Gläubige in eine priesterlose Zukunft zu führen.
Wenn wir den Auftrag, den Glauben zu verbreiten, nicht nur an die kirchlichen Amtsträger richten, sondern auch auf uns beziehen, stellen wir uns die Frage, wieviel Menschen wir in diesem Monat für den Glauben gewonnen, wieviel wir verloren haben. Eine negative Bilanz wird uns sagen, dass wir etwas grundlegend erneuern müssen.
Bei diesem Reformwillen machen wir uns bewusst, dass die katholische (weltumspannende) Kirche einen inneren Zusammenhalt braucht, der Papst die schwere Aufgabe hat, diesen Zusammenhalt zu gewährleisten. Doch lehrt uns auch die Erfahrung mit modernen Bundesstaaten, dass Zentralismus die Herrschaft der Schreibstuben – der Bürokratie – fördert. Ein Entscheiden ohne Gespräch mit den Betroffenen verbreitet Monotonie und hemmt Entwicklungen. Ein gelebter Zusammenhalt wird durch eine maßvolle Dezentralisierung und eine Entfaltung der kulturellen Einheit in Vielfalt erreicht. Unsere Universitäten sind so erfolgreich, weil sie in Mainz, Frankfurt, Heidelberg, Freiburg und München wirken. Sie wären weniger leistungsfähig, wenn sie alle in Berlin-Brandenburg angesiedelt wären. Das Wormser Konkordat wäre nicht gelungen, wenn nur in Mainz, nicht auch in Worms und dann in Speyer ein Dom errichtet worden wäre.
Der Papst sagt, Synodalität gehöre zum Wesen unserer Kirche, erfordere ein „unabgeschlossenes“ Denken. Im Rahmen eines weltweiten synodalen Prozesses unserer Kirche hat ein Synodalforum mit großer Mehrheit der Bischöfe und der anderen Gläubigen den Weg zu einem Synodalen Rat für die katholische Kirche in Deutschland begonnen, der durch einen synodalen Ausschuss vorbereitet wird und eine Kultur des Miteinander sowie eine innere Haltung der Kritikfähigkeit und der gemeinsamen Suche nach einem tragfähigen Erneuerungskonzept entwickeln will. Dieser prozedurale Weg aus einer anfänglichen Ausweglosigkeit, aus einem Prozess des Lernens, Stolperns und Wiederaufstehens entspricht der Klugheit des Wormser Konkordats, das den Aufbruch in eine neue Kirchlichkeit auf den Weg eines ausgleichenden Verfahrens gebracht hat.
a. Die Qualifikation zu Kirchenaufgaben
Bei der Neugestaltung der Kirchenorganisation ist bewusst, dass ein kirchlicher Amtsträger kraft Weihe für priesterliche Aufgaben berufen, deshalb aber noch nicht ein guter Dienstherr ist. Er arbeitet mit Organisations- und Finanzfachleuten, hat einen Dombaumeister, einen Liegenschaftsverwalter, Schulaufseher, Krankenhausleiter und Entwicklungsplaner. Ein Bischof muss sich mit diesen Sachkundigen im Wechselspiel dies Wissens austauschen. Deswegen braucht die Kirche Strukturen der Delegation, der unterschiedlichen Qualifikation für die jeweilige Aufgabe, der strukturierenden Legitimation von Herrschaft.
Damit wird keine „Demokratisierung“ der Kirchen empfohlen. „Demokratie“ ist eine Staatsform, die Macht auf Zeit gewährt, politische Alternativen der Interessen und Betroffenheiten im Gegeneinander von Regierung und Opposition organisiert, dem heute Mächtigen stets eine Alternative eines anderen Herrschers gegenüberstellt. Dies ist nicht das Konzept eines kirchlichen Lehramtes. Wir brauchen strukturell nicht einen stetigen „Gegenpapst“, nicht einen stetigen „Gegenbischof“, nicht einen alternativen Ortspfarrer. Doch auch kirchliche Amtsträger müssen sich vor den ihnen anvertrauten Menschen rechtfertigen. Der Auftrag der Kirche ist die Frohe Botschaft an die Menschen, der geistig inspirierende Einfluss auf die Menschen, das Zusammenwirken von Gotteserfahrung und Mystik in Glaubensgemeinschaft. Für die kirchliche Rechtsetzung lehrt das Wormser Konkordat: Wer Recht fertigt, muss sich rechtfertigen.
b. Amt und Laien
Ein kritikwürdiges Stichwort ist die Unterscheidung zwischen kirchlichen Amtsträgern und „Laien“ – griechisch: laós, das Volk ohne Fachausbildung. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft sind wir alle überwiegend Laien. Der Arzt kann operieren, der Kfz-Meister das Auto reparieren, der Jurist das Recht handhaben. Jeder braucht die Fachqualifikation des anderen, kennt seine eigene Unzulänglichkeit. Deswegen sollte die Kirche vermehrt Teile der Gemeindearbeit nichtpriesterlichen Amtsträgern übertragen und unter Priestern eine kollegiale Arbeitsteilung organisieren.
Ich hatte einmal eine Diskussion in einem kleinen Kreis mit Bischöfen, in dem wir eine Frage des Finanzverfassungsrechts in großer Offenheit erörtert haben. Nachdem eine gemeinsame Lösung gefunden war, bat der Vorsitzende mich um Verständnis, dass die nunmehr zu treffende Entscheidung nach kirchlichem Recht „ohne Laien“ getroffen werden müsse. Ich fragte ihn, ob nach diesen Prinzipien ich allein die Entscheidung zu treffen habe. Dieser Einwand schien anfangs befremdlich, wurde dann mit wohlwollendem Kopfschütteln bedacht, führte schließlich nach einer eleganten Dispensbemerkung des Vorsitzenden zu einer von allen Beteiligten getragenen –einvernehmlichen – Lösung. Wir haben vereinbart, über dieses Erlebnis öffentlich zu sprechen.
c. Männer und Frauen
Die Unterscheidung zwischen Mann und Frau hat mehr als 2000 Jahre das öffentliche Leben in allen Gemeinwesen bestimmt. In der Vergangenheit war politische Macht – die Leitung eines Staatsvolkes oder einer Gemeinde, die Bestimmungsmacht in der Wirtschaft – Sache der Männer. Doch heute sollte die Kirche prüfen, ob sie in ihrer Verantwortung für diese heutige Welt noch vertreten kann, Frauen vom Priesteramt fernzuhalten.
Wenn meine Frau und ich an Weihnachten das Weihnachtsoratorium hören, erleben wir im Duett immer wieder eine der schönsten und eindringlichsten Formen der Gottesverehrung durch Sopran und Tenor. Hier darf weder die eine noch der andere fehlen. Das Lob Gottes wird in der Vielfalt und Breite dessen verkündet, was dem Menschen möglich, was dem mit gleicher gottgegebener Würde ausgestatteten Männern und Frauen von der Schöpfung zugedacht ist.
Deswegen sollten mit einem Priestertum der Frau die unterschiedlichen Talente für den Glauben zur Entfaltung gebracht werden.
d. Das Zölibat
Ob das Zölibat das erste Jahrtausend des Christentums geprägt hat, ist zweifelhaft. Ob die Einführung des Zölibats vordergründige erbrechtliche Ziele verfolgte, ist historisch offen. Für die Gegenwart jedenfalls ist gewiss, dass für bestimmte Regionen, für bestimmte orthodoxe Priester, auch für verheiratete Priester, die zum katholischen Glauben wechseln, die Ausnahmefälle des verheirateten Priesters mehr als bloße Dispense sind.
Das Zölibat erlaubt dem Priester, sich ausschließlich seinem Amt zu widmen, entlastet ihn von der Sorge um die eigene Familie. Doch kann dem Zölibatär in seinem schweren Amt der Ehepartner als Gesprächspartner fehlen, ihm die Familie als Lebens- und Erfahrungsgemeinschaft, als Beistands- und Ermutigungsgemeinschaft, als Ausgangspunkt für Gemeinde, Staatsvolk und Staat vorenthalten werden. Die Kirche sollte den Versuch wagen, verheiratete und unverheiratete Priester zuzulassen. Sie würde damit ihren Auftrag erfüllen, den Menschen genügend Priester zu geben. Ihnen diese Priester zu verweigern, wäre unverantwortlich.
5. Gegenseitige Ergänzung von Staat und Kirche
Die Erneuerung von Staat und Kirche ist auf ein Zusammenwirken zwischen Staat und Kirche angelegt. Ein erster großer Schritt zur religiösen Erneuerung könnte rechtlich ein neues Wormser Konkordat sein, in dem der Papst dem Staat zusagt, den deutschen Bischöfen in einer Experimentierklausel zu gestatten, ein neues Verständnis von Amt und Laien, von Männern und Frauen, von Zölibat, Arbeitsteilung und Delegation zu erproben und vor der Weltkirche zu verantworten. Der Staat könnte dem Papst korrespondierend zusagen, dass er die so erneuerte Kirche vermehrt als Quelle seiner Verfassungsstaatlichkeit stützen und zur Entfaltung bringen, zur Qualifikation für religiöse Mündigkeit und geistige Weite in Staatsorganisation und Staatsentscheidungen beitragen, seinen Bürgern staatliche Pflege von Freiheitsvoraussetzungen in rechtlicher, institutioneller und finanzieller Förderung anbieten wird.
Überwinden wir die gegenwärtigen Ermüdungs- und Lähmungserscheinungen des Religiösen durch ein historisch fundiertes Vertrauen auf den ständigen Wiederaufstieg der Kirche in 2000 Jahren wechselvoller Geschichte. Wagen wir die Kühnheit christlicher Nächstenliebe. Wenn uns heute ein solches Konkordat oder andere Wege zu einem christlichen Dialog gelingen, werden unsere Nachfahren in 900 Jahren sich darüber freuen.